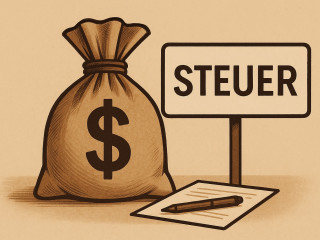Weltwirtschaft im Umbruch: Handelskonflikte, Zinsentscheidungen und wirtschaftliche Unsicherheiten
Die globale Wirtschaft steht Anfang 2025 vor großen Herausforderungen. Während die USA und China ihr Wachstum behaupten, stagniert die Wirtschaft im Euroraum. Besonders Deutschland leidet unter schwachen Exporten und einer gedämpften Industrieproduktion. Die jüngste Ausgabe des Monatsberichts der Deutschen Bundesbank (Februar 2025)analysiert detailliert die aktuellen Entwicklungen in Weltwirtschaft, Finanzmärkten und Geldpolitik.
Internationale Konjunktur: Uneinheitliches Bild und wachsende Risiken
Laut der Bundesbank expandierte die Weltwirtschaft im vierten Quartal 2024 moderat. Die Dynamik fiel jedoch regional sehr unterschiedlich aus: In den USA blieb das Wachstum robust, während China durch staatliche Konjunkturmaßnahmen und starke Exporte gestützt wurde. Im Euroraum hingegen stieg die Wirtschaftsleistung nur leicht – auch, weil positive Sondereffekte aus dem Sommer, wie die Olympischen Spiele in Paris, wegfielen.
Ein bedeutender Unsicherheitsfaktor für den globalen Handel bleibt die Handelspolitik der USA. Mit dem Amtsantritt von Präsident Donald Trump im Januar 2025 wurden Importzölle auf chinesische Waren angehoben, wenn auch nicht so drastisch wie zuvor angekündigt. Zudem setzte die US-Regierung zusätzliche Abgaben auf Stahl- und Aluminiumimporte in Kraft. Die Bundesbank warnt in ihrem Bericht, dass solche Maßnahmen Gegenreaktionen anderer Staaten auslösen und Handelskonflikte eskalieren könnten, was die weltwirtschaftliche Entwicklung erheblich belasten würde.
Inflation und Zinsen: Geldpolitik im Spannungsfeld
Die Inflationsdynamik zeigt laut Bundesbank ein gemischtes Bild. Während die Gesamtinflation durch gesunkene Energiepreise zwischenzeitlich gedämpft wurde, verharrt die Kerninflation – also ohne Energie und Nahrungsmittel – auf einem erhöhten Niveau. In den Industrieländern stieg die Verbraucherpreisinflation im Januar 2025 auf 2,9 %, nach 2,4 % im Oktober 2024. Besonders im Dienstleistungssektor bleibt der Preisauftrieb hoch.
Die Europäische Zentralbank (EZB) reagierte darauf mit zwei Leitzinssenkungen um jeweils 25 Basispunkte im Dezember 2024 und Januar 2025, sodass der Zinssatz für die Einlagefazilität nun bei 2,75 % liegt. Die Bundesbank verweist darauf, dass die EZB ihre Kommunikation angepasst und den Hinweis auf eine „restriktive Geldpolitik“ entfernt hat. Zukünftige Zinsentscheidungen sollen stärker von der aktuellen Datenlage abhängig gemacht werden.
In den USA hingegen bleibt die Fed vorsichtiger. Der Disinflationsprozess verläuft dort langsamer, weshalb für 2025 lediglich eine weitere Zinssenkung erwartet wird. Dies hat direkte Auswirkungen auf die Finanzmärkte: Die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen sind deutlich gestiegen, was auf robuste US-Wirtschaftsdaten und steigende Inflationserwartungen zurückzuführen ist. Der Euro verlor gegenüber dem US-Dollar spürbar an Wert, da Investoren mit einer länger anhaltenden Zinsdifferenz zwischen den USA und der Eurozone rechnen.
Aktienmärkte: Optimismus trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten
Trotz der wirtschaftlichen Herausforderungen entwickelten sich die internationalen Aktienmärkte positiv. Wie die Bundesbank im Monatsbericht analysiert, führte der gestiegene Risikoappetit zu Kursgewinnen, insbesondere bei US-Werten. Bankaktien profitierten von der Erwartung, dass regulatorische Lockerungen unter der neuen US-Regierung für höhere Margen sorgen könnten.
In Europa bleibt die Lage dagegen weniger optimistisch. Die deutsche Wirtschaft schrumpfte im vierten Quartal 2024 überraschend um 0,2 %. Laut Schnellschätzung des Statistischen Bundesamts, die auch die Bundesbank aufgreift, gingen insbesondere die Exporte zurück. Zwar unterstützten steigende Löhne den privaten Konsum, doch die hohen Finanzierungskosten und die schwache Nachfrage aus dem Ausland belasten die Investitionstätigkeit der Unternehmen.
Auch der Arbeitsmarkt zeigt Anzeichen einer Abkühlung. Die Beschäftigung stagnierte, während die Kurzarbeit insbesondere in der Industrie spürbar zunahm. Dennoch stiegen die Löhne weiter – im vierten Quartal um 5,8 % im Vergleich zum Vorjahr. In den Dienstleistungen konnten höhere Löhne leichter durchgesetzt werden als in der Industrie.
Staatsfinanzen: Hohe Defizite und neue EU-Fiskalregeln
Die Bundesbank weist in ihrem Bericht auf die angespannten Staatsfinanzen hin. Das gesamtstaatliche Defizit in Deutschland lag 2024 weiterhin bei 2,5 % des BIP, und auch für 2025 ist keine wesentliche Verbesserung in Sicht. Zwar konnte der Bund die Vorgaben der Schuldenbremse einhalten, doch das finanzstatistische Defizit blieb hoch. Besonders die steigenden Sozial- und Verteidigungsausgaben setzen die Haushaltsplanung unter Druck.
Auch auf europäischer Ebene kommen neue fiskalpolitische Herausforderungen auf die Staaten zu. Im Rahmen der ersten Anwendung der neuen EU-Fiskalregeln wurden für 22 der 27 Mitgliedstaaten mehrjährige Obergrenzen für das Ausgabenwachstum festgelegt. Während einige Länder wie Spanien und Portugal eine Reduktion ihrer Schuldenquoten anstreben, verzeichnen hoch verschuldete Länder wie Frankreich und Italien weiterhin steigende Schuldenquoten. Die Bundesbank betont, dass es entscheidend sein wird, die neuen Regeln konsequent umzusetzen, um langfristig stabile Staatsfinanzen zu gewährleisten.
Ausblick: Keine schnelle Erholung in Sicht
Die Bundesbank kommt in ihrer Analyse zu dem Schluss, dass die Weltwirtschaft weiterhin unter Unsicherheiten leidet. Besonders die Handelspolitik der USA bleibt ein Risikofaktor für die globale Konjunktur.
Für Deutschland könnte sich die Wirtschaftsleistung im ersten Quartal 2025 stabilisieren, insbesondere wenn sich die Exporte erholen. Dennoch bleibt die Grundtendenz schwach. Hohe Finanzierungskosten, wirtschaftliche Unsicherheit und strukturelle Herausforderungen in der Industrie lassen eine schnelle Erholung unwahrscheinlich erscheinen.
Angesichts dieser Entwicklung wird die Geldpolitik eine entscheidende Rolle spielen. Während die EZB mit Zinssenkungen versucht, die Wirtschaft zu stabilisieren, bleibt die Fed zurückhaltend. Die Finanzmärkte werden weiterhin stark von Inflations- und Zinsentwicklungen beeinflusst.
Letztlich bestätigt der Monatsbericht der Bundesbank (Februar 2025), dass sich die Weltwirtschaft in einer Phase hoher Unsicherheit befindet. Ob sich die aktuelle wirtschaftliche Schwächephase bald auflöst oder weiter verstärkt, wird maßgeblich von politischen Entscheidungen und der Entwicklung der globalen Handelsbeziehungen abhängen.
Themen:
LESEN SIE AUCH
Israel/Iran-Konflikt: „Märkte unterschätzen geopolitische Risiken“ - Warnung vor Eskalation und Preisauftrieb
Der Angriff Israels auf den Iran hat die Finanzmärkte in eine Fluchtbewegung versetzt. Doch für Mark Dowding von RBC BlueBay Asset Management ist dies nur ein Vorgeschmack: Steigende Ölpreise, anhaltender Handelskonflikt und eine unterschätzte Inflation könnten bald stärker durchschlagen. Was Anleger jetzt beachten sollten…
EZB senkt erneut Leitzins – Trump-Zölle verschärfen wirtschaftliche Unsicherheit
Die Europäische Zentralbank setzt ihren Kurs der Zinssenkungen fort. Während die Inflation weiter sinkt, sorgt US-Präsident Trump mit neuen Zollplänen für wachsende wirtschaftliche Spannungen.
Bundestagswahl hinterlässt kaum Spuren an den Finanzmärkten
Die Märkte haben gelassen auf das Wahlergebnis in Deutschland reagiert. Während der Euro leicht zulegte und Aktien-Futures moderat im Plus notieren, bleiben die Bewegungen am Anleihemarkt verhalten. Laut Annalisa Piazza, Anleiheexpertin bei MFS Investment Management, sind viele Risiken bereits eingepreist. Doch der finanzpolitische Kurs der neuen Bundesregierung wird genau beobachtet – insbesondere mit Blick auf Konjunktur, Schuldenbremse und Verteidigungsausgaben.
Wirtschaftswachstum gibt Anlass zur Vorsicht, aber nicht zur Panik
Das Risiko einer bevorstehenden harten Landung der Wirtschaft ist heute geringer als noch vor drei Monaten. Es ist aber von einem unterdurchschnittlichen Wachstum bis 2024 auszugehen - und so seltsam es klingt, Grund dafür ist ausgerechnet die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit.
Unsere Themen im Überblick
Themenwelt
Wirtschaft
Management
Recht
Finanzen
Assekuranz
Mindestlohn steigt bis 2027 auf 14,60 Euro – Kommission warnt vor politischer Einflussnahme
Der gesetzliche Mindestlohn soll in zwei Stufen auf 14,60 Euro pro Stunde angehoben werden. Der einstimmige Beschluss der Mindestlohnkommission sorgt für politische und wirtschaftliche Debatten – zwischen sozialem Anspruch und wirtschaftlicher Tragfähigkeit.
Fiskalische Zeitenwende oder riskante Halse? Deutschlands Investitions- und Verteidigungskurs im Stresstest
Deutschland steht vor einem wirtschafts- und sicherheitspolitischen Kraftakt historischen Ausmaßes. Mit einem 500-Milliarden-Euro-Investitionspaket und dem Ziel, die Verteidigungsausgaben auf 3,5 % des BIP zu steigern, wagt die Bundesregierung eine fiskalische Zeitenwende. Doch der Spagat zwischen Wachstumsimpulsen, geopolitischer Abschreckung und haushaltspolitischer Stabilität ist riskant – ökonomisch wie gesellschaftlich.
Stromsteuer-Senkung bleibt aus: Verbraucher außen vor
Die Bundesregierung verabschiedet sich von ihrem Versprechen, die Stromsteuer für alle Verbraucher auf das EU-Mindestmaß zu senken. Nur Industrie und Landwirtschaft sollen entlastet werden. Während Ministerin Reiche von „finanzieller Wirklichkeit“ spricht, wirft der Steuerzahlerbund der Regierung einen Wortbruch vor. Die Entscheidung trifft besonders Mittelstand und Haushalte – und beschädigt die politische Glaubwürdigkeit der Ampel.
Ertragsteuern im Rückwärtsgang – aber Lohn- und Umsatzsteuer stabilisieren die Einnahmelage
Wie das Bundesfinanzministerium im Monatsbericht Juni 2025 mitteilt, hat sich das Steueraufkommen im Mai weiter positiv entwickelt – mit einer wichtigen Ausnahme: Die Ertragsteuern geraten spürbar unter Druck. Während Lohn- und Umsatzsteuer verlässlich tragen, wirft der Rückgang bei den ertragsbezogenen Einnahmen Fragen nach der konjunkturellen Substanz auf.
Die neue Ausgabe kostenlos im Kiosk
Werfen Sie einen Blick in die aktuelle Ausgabe und überzeugen Sie sich selbst vom ExpertenReport. Spannende Titelstories, fundierte Analysen und hochwertige Gestaltung – unser Magazin gibt es auch digital im Kiosk.