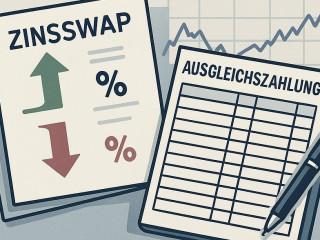Der Bundesgerichtshof hat entschieden: Wohnungseigentümer haben grundsätzlich einen Anspruch auf die plangerechte Ersterrichtung des Gemeinschaftseigentums – unter engen Bedingungen. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Zumutbarkeit für die übrigen Eigentümer.
In einem wegweisenden Urteil vom 20. Dezember 2024 (Az. V ZR 243/23) hat der Bundesgerichtshof (BGH) entschieden, dass Wohnungseigentümer im Fall eines sogenannten steckengebliebenen Bauvorhabens grundsätzlich einen Anspruch auf die erstmalige plangerechte Errichtung des Gemeinschaftseigentums haben. Dieser Anspruch wird jedoch durch den Grundsatz von Treu und Glauben begrenzt, wenn die Erfüllung für die übrigen Wohnungseigentümer unzumutbar ist.
Der Sachverhalt
Im verhandelten Fall war ein geplantes Bauprojekt nach Beginn der Abrissarbeiten ins Stocken geraten. Eine Insolvenz der Generalbauunternehmerin hatte dazu geführt, dass das geplante Gebäude nie fertiggestellt wurde. Eine Wohnungseigentümerin forderte daraufhin, dass die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer die Errichtung des Gemeinschaftseigentums in die Wege leitet. Ihre Anträge auf Einholung von Gutachten und Angebote sowie die Finanzierung über eine Sonderumlage wurden jedoch in einer Eigentümerversammlung abgelehnt.
Nachdem das Landgericht Koblenz zunächst zugunsten der Eigentümerin entschieden hatte, hob der BGH das Urteil auf und verwies den Fall zurück.
Die Rechtslage
Der BGH stellte klar, dass ein Anspruch auf Ersterrichtung des Gemeinschaftseigentums auch bei unfertigen Bauprojekten besteht, sofern bereits ein Binnenverhältnis zwischen den Wohnungseigentümern entstanden ist. Diese Ansprüche basieren auf § 18 WEG, der eine ordnungsmäßige Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums vorsieht.
Die Grenzen des Anspruchs
Der Anspruch ist jedoch begrenzt, wenn die Ersterrichtung für die übrigen Wohnungseigentümer unzumutbar ist. Die Unzumutbarkeit kann sich aus mehreren Faktoren ergeben, darunter:
- Kostensteigerungen: Erhebliche Mehrkosten – insbesondere über 50 % der ursprünglich kalkulierten Kosten – können die Zumutbarkeit infrage stellen.
- Wirtschaftlich sinnvolle Alternativen: Gibt es Investoren, die das unfertige Gebäude erwerben möchten, kann dies eine praktikable Lösung darstellen.
- Umfang der Arbeiten: Der Fertigstellungsgrad und der Umfang der noch notwendigen Arbeiten spielen eine zentrale Rolle.
Das Landgericht muss nun im Rahmen einer Gesamtabwägung prüfen, ob die Ersterrichtung unter den gegebenen Umständen zumutbar ist. Eine starren Grenze, wie bei § 22 WEG, gibt es in diesen Fällen nicht.
Themen:
LESEN SIE AUCH
Fristenkontrolle: Anwälte müssen nicht doppelt prüfen
Rechtsanwälte müssen Fristen nicht doppelt prüfen, sofern sie sich auf eine funktionierende Organisation und die Vermerke in den Handakten verlassen können, entschied das Bundesarbeitsgericht (BAG). Das hat nicht nur praktische, sondern auch haftungsrechtliche Konsequenzen.
Allianz unterliegt vor Gericht: Riester-Rente darf nicht gekürzt werden
Ein bedeutendes Urteil des Oberlandesgerichts Stuttgart sorgt für Aufsehen in der Versicherungsbranche: Die Allianz Lebensversicherungs-AG darf eine umstrittene Klausel in ihren fondsgebundenen Riester-Rentenverträgen nicht mehr verwenden.
Altersgrenze für Notare ist keine unzulässige Diskriminierung
Die Altersgrenze soll den Generationenwechsel erleichtern und den Berufsstand der Notare verjüngen. Nach Ermessen des Senats für Notarsachen ist sie zur Erreichung dieses Ziels weiterhin erforderlich, da im hauptberuflichen Notariat bundesweit ein klarer Bewerberüberhang herrscht.
Verfassungsbeschwerde im Dieselstreit abgewiesen – Bundesverfassungsgericht bestätigt Revisionsurteil eines Hilfssenats
Das Bundesverfassungsgericht hat die Verfassungsbeschwerde eines Autoherstellers gegen ein Revisionsurteil des Bundesgerichtshofs in einem Dieselverfahren nicht zur Entscheidung angenommen – und stärkt damit die Rolle des VIa. Zivilsenats als Hilfssenat.
Unsere Themen im Überblick
Themenwelt
Wirtschaft
Management
Recht
Finanzen
Assekuranz
Reitunterricht als Freizeitgestaltung: BFH schränkt Umsatzsteuerbefreiung deutlich ein
Der Bundesfinanzhof hat entschieden: Reitunterricht ist nur dann von der Umsatzsteuer befreit, wenn er klar berufsbezogen ist. Freizeitangebote wie Ponyreiten oder Klassenfahrten gelten als steuerpflichtig.
BFH-Urteil: Steuerliche Folgen bei Grundstücksübertragungen mit Schuldübernahme
Wer ein Grundstück innerhalb von zehn Jahren nach dem Kauf überträgt und dabei bestehende Schulden vom Erwerber übernehmen lässt, muss mit einer Einkommensteuerpflicht rechnen.
BGH: Krankentagegeldversicherung – Versicherer dürfen Tagessatz nicht einseitig herabsetzen
Der Bundesgerichtshof (BGH, Az. IV ZR 32/24) hat entschieden, dass Versicherer den Tagessatz in der Krankentagegeldversicherung nicht einseitig senken dürfen, wenn das Einkommen des Versicherungsnehmers sinkt. Dies gilt selbst dann, wenn die Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) eine entsprechende Klausel enthalten, die nachträglich ersetzt wurde.
E-Scooter: Trunkenheitsfahrt kann Führerschein kosten
E-Scooter-Fahrer sind im Straßenverkehr nicht besser gestellt als Autofahrer. Wer alkoholisiert fährt, muss mit Konsequenzen rechnen – bis hin zum Führerscheinentzug. Das Oberlandesgericht Hamm hat entschieden, dass bereits ab 1,1 Promille absolute Fahruntüchtigkeit besteht.
Die neue Ausgabe kostenlos im Kiosk
Werfen Sie einen Blick in die aktuelle Ausgabe und überzeugen Sie sich selbst vom ExpertenReport. Spannende Titelstories, fundierte Analysen und hochwertige Gestaltung – unser Magazin gibt es auch digital im Kiosk.