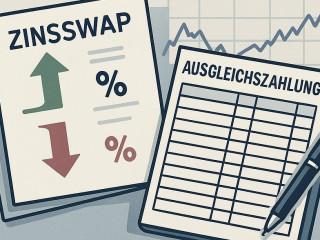Der Bundesgerichtshof hat die Berechnung des Selbstbehalts beim Elternunterhalt neu bewertet. Damit wird die Anwendung der Einkommensgrenze von 100.000 Euro aus dem Angehörigen-Entlastungsgesetz genauer eingeordnet.
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in einem aktuellen Urteil (Az. XII ZB 6/24) wichtige Klarstellungen zur Höhe des angemessenen Selbstbehalts beim Elternunterhalt getroffen. Dabei wurde die Einkommensgrenze von 100.000 Euro, die durch das Angehörigen-Entlastungsgesetz eingeführt wurde, näher beleuchtet und ihre Bedeutung im zivilrechtlichen Unterhaltsrecht präzisiert.
Hintergrund
Geklagt hatte ein Sozialhilfeträger, der von einem gutverdienenden Sohn einer pflegebedürftigen Mutter Elternunterhalt forderte. Die Mutter konnte die Kosten für ihre stationäre Pflege nicht vollständig selbst tragen. Das Oberlandesgericht hatte die Klage mit Verweis auf einen Selbstbehalt von 9.000 Euro für verheiratete Unterhaltspflichtige abgewiesen. Dieser Wert orientierte sich an der Einkommensgrenze des Angehörigen-Entlastungsgesetzes.
Der BGH hob die Entscheidung auf und stellte fest, dass die Anwendung dieser Grenze im zivilrechtlichen Unterhaltsrecht nicht zulässig ist. Das Gesetz regelt lediglich den sozialhilferechtlichen Rückgriff und verändert die bürgerlich-rechtliche Unterhaltspflicht nicht.
Wichtige Klarstellungen des BGH
-
Einkommensgrenze nicht bindend:
Die im Angehörigen-Entlastungsgesetz festgelegte Grenze von 100.000 Euro Jahresbruttoeinkommen ist nicht maßgeblich für die Berechnung des Selbstbehalts beim Elternunterhalt. Der BGH betonte, dass das Gesetz den sozialhilferechtlichen Rückgriff regelt, nicht aber die zivilrechtliche Unterhaltspflicht. -
Angemessener Selbstbehalt:
Die vom OLG angesetzten Selbstbehalte (5.000 Euro für Alleinstehende, 9.000 Euro für Verheiratete) wurden als systemfremd und zu hoch bewertet. Die aktuellen Leitlinien einiger Oberlandesgerichte, die von einem Selbstbehalt von 2.650 Euro ausgehen, wurden hingegen als rechtlich unbedenklich eingestuft. -
Erweiterter Einkommensschutz:
Der BGH deutete an, dass Unterhaltspflichtigen künftig ein größerer Anteil ihres bereinigten Einkommens über den Selbstbehalt hinaus verbleiben könnte – etwa 70 Prozent.
Bedeutung für die Praxis
Mit diesem Urteil schafft der BGH mehr Rechtssicherheit und grenzt den Anwendungsbereich des Angehörigen-Entlastungsgesetzes klar ab. Unterhaltspflichtige können sich nicht auf die sozialhilferechtliche Einkommensgrenze berufen, sondern müssen ihre Leistungsfähigkeit nach den allgemeinen Grundsätzen des Unterhaltsrechts prüfen lassen.
Das Urteil ist ein wichtiger Schritt, um die Balance zwischen sozialhilferechtlichem Schutz und zivilrechtlicher Leistungsfähigkeit zu wahren. Weitere Details zur Umsetzung werden nun in der nächsten Instanz geklärt.
Themen:
LESEN SIE AUCH
Millionenbetrug mit Schein-Beitritten zu Genossenschaft - BGH bestätigt Urteil
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat die Verurteilung zweier Angeklagter wegen gewerbsmäßigen Betrugs durch das Landgericht Weiden i.d.OPf. bestätigt. Die Angeklagten hatten über eine Genossenschaft vermeintlich vermögenswirksame Leistungen angeboten, ohne die gesetzlichen Formvorschriften einzuhalten.
BGH: Krankentagegeldversicherung – Versicherer dürfen Tagessatz nicht einseitig herabsetzen
Der Bundesgerichtshof (BGH, Az. IV ZR 32/24) hat entschieden, dass Versicherer den Tagessatz in der Krankentagegeldversicherung nicht einseitig senken dürfen, wenn das Einkommen des Versicherungsnehmers sinkt. Dies gilt selbst dann, wenn die Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) eine entsprechende Klausel enthalten, die nachträglich ersetzt wurde.
Fristenkontrolle: Anwälte müssen nicht doppelt prüfen
Rechtsanwälte müssen Fristen nicht doppelt prüfen, sofern sie sich auf eine funktionierende Organisation und die Vermerke in den Handakten verlassen können, entschied das Bundesarbeitsgericht (BAG). Das hat nicht nur praktische, sondern auch haftungsrechtliche Konsequenzen.
Allianz unterliegt vor Gericht: Riester-Rente darf nicht gekürzt werden
Ein bedeutendes Urteil des Oberlandesgerichts Stuttgart sorgt für Aufsehen in der Versicherungsbranche: Die Allianz Lebensversicherungs-AG darf eine umstrittene Klausel in ihren fondsgebundenen Riester-Rentenverträgen nicht mehr verwenden.
Unsere Themen im Überblick
Themenwelt
Wirtschaft
Management
Recht
Finanzen
Assekuranz
Reitunterricht als Freizeitgestaltung: BFH schränkt Umsatzsteuerbefreiung deutlich ein
Der Bundesfinanzhof hat entschieden: Reitunterricht ist nur dann von der Umsatzsteuer befreit, wenn er klar berufsbezogen ist. Freizeitangebote wie Ponyreiten oder Klassenfahrten gelten als steuerpflichtig.
BFH-Urteil: Steuerliche Folgen bei Grundstücksübertragungen mit Schuldübernahme
Wer ein Grundstück innerhalb von zehn Jahren nach dem Kauf überträgt und dabei bestehende Schulden vom Erwerber übernehmen lässt, muss mit einer Einkommensteuerpflicht rechnen.
E-Scooter: Trunkenheitsfahrt kann Führerschein kosten
E-Scooter-Fahrer sind im Straßenverkehr nicht besser gestellt als Autofahrer. Wer alkoholisiert fährt, muss mit Konsequenzen rechnen – bis hin zum Führerscheinentzug. Das Oberlandesgericht Hamm hat entschieden, dass bereits ab 1,1 Promille absolute Fahruntüchtigkeit besteht.
Widerrufsbelehrung: Urteil zugunsten von AXA – Verbraucherschützer prüfen nächste Schritte
Der Bund der Versicherten (BdV) und die Verbraucherzentrale Hamburg haben vor dem Oberlandesgericht Köln eine Niederlage erlitten. Die Klage gegen die Widerrufsbelehrung der AXA Relax PrivatRente Chance wurde abgewiesen (Az. 20 UKl 1/24). Das Gericht entschied, dass die Belehrung den gesetzlichen Anforderungen entspricht.
Die neue Ausgabe kostenlos im Kiosk
Werfen Sie einen Blick in die aktuelle Ausgabe und überzeugen Sie sich selbst vom ExpertenReport. Spannende Titelstories, fundierte Analysen und hochwertige Gestaltung – unser Magazin gibt es auch digital im Kiosk.