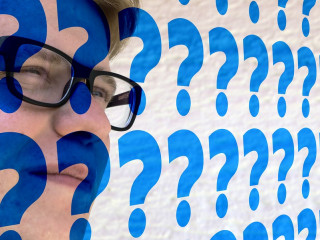Rentenangleichung mit Nebenwirkungen: Warum viele Ostdeutsche künftig weniger Rente erhalten
Zum 1. Juli 2025 wird ein lang geplantes Projekt vollendet: die vollständige Angleichung der Rentensysteme zwischen Ost- und Westdeutschland. Die Maßnahme gilt als historischer Meilenstein – doch sie hat eine Kehrseite. Denn für viele Beschäftigte in den neuen Bundesländern bedeutet diese „Gleichstellung“ de facto eine Rentenkürzung. Die Ursache liegt in einem kleinen, unscheinbaren Detail des Rentensystems: den sogenannten Entgeltpunkten. Wer weniger verdient, erhält weniger Punkte – und damit langfristig eine niedrigere Rente. Die Auswirkungen dieser Systemumstellung lassen sich am besten anhand eines konkreten Rechenbeispiels nachvollziehen.
Rentenpunkte: Das Maß der Dinge
Die gesetzliche Rentenversicherung in Deutschland funktioniert nach einem Punktesystem. Für jedes Jahr, in dem eine oder ein Versicherter genau das durchschnittliche Bruttojahreseinkommen aller Versicherten verdient, gibt es einen vollen Rentenpunkt. Wer mehr verdient, sammelt entsprechend mehr Punkte, wer weniger verdient, entsprechend weniger.
Bisher wurde dieses Prinzip durch einen sogenannten Umrechnungsfaktor im Osten Deutschlands abgefedert. Dieser Faktor sorgte dafür, dass Ostdeutsche trotz niedrigerer Löhne auf mehr Entgeltpunkte kamen – eine Form des strukturellen Ausgleichs. Mit dem Stichtag 1. Juli 2025 fällt dieser Ausgleich endgültig weg. Künftig zählt das bundesweite Durchschnittsentgelt einheitlich – egal, ob jemand in Leipzig oder in München arbeitet.
Ein Rechenbeispiel: Gleiche Arbeit, ungleiche Rente
Die Deutsche Rentenversicherung weisst jedes Jahr die durchschnittlichen Entgelte aus. Leider wird hier nicht nach Bundesland unterschieden. Wir müssen uns deshalb den Zahlen des Statistischen Bundesamtes bedienen. Die Erhebungen beider Einrichtungen sind nicht gleich und weichen deshalb geringfügig voneinander ab. Für unser Beispiel kann das jedoch vernachlässigt werden.
Das Statistische Bundesamt gibt für das Jahr 2023 folgende Bruttomonatslöhne an:
Westdeutschland: 4.586 €
Ostdeutschland: 3.769 €
Aufs Jahr gerechnet ergeben sich damit:
Westen: 4.586 € × 12 = 55.032 €
Osten: 3.769 € × 12 = 45.228 €
Das bundesweite Durchschnittsentgelt lag laut der Deutschen Rentenversicherung im Jahr 2024 bei etwa 45.358 € – genau dieser Wert wird zur Berechnung eines vollen Rentenpunkts herangezogen.
Was heißt das konkret? Wer in Westdeutschland 55.032 € verdient, liegt damit etwa 21,3 % über dem Durchschnitt und erhält jährlich:
55.032 / 45.358 ≈ 1,21 Rentenpunkte pro Jahr
Im Osten hingegen liegt das Einkommen mit 45.228 € knapp unter dem Durchschnitt, was zu folgendem Ergebnis führt:
45.228 / 45.358 ≈ 0,997 Rentenpunkte pro Jahr
Für die Langzeitwirkung multiplizieren wir diese jährlichen Rentenpunkte mit einer typischen Lebensarbeitszeit – hier angesetzt mit 40 Jahren:
Westdeutschland: 40 × 1,21 = 48,4 Rentenpunkte
Ostdeutschland: 40 × 0,997 = 39,88 Rentenpunkte
Jeder Rentenpunkt ist derzeit mit 40,79 € brutto pro Monat bewertet (Stand 2024). Daraus ergibt sich folgende monatliche Bruttorente:
West: 48,4 × 40,79 € = 1.974,23 €
Ost: 39,88 × 40,79 € = 1.626,70 €
Das ergibt eine Differenz von 342,64 € monatlich – bei gleicher Lebensarbeitszeit und gleichem Engagement. Über ein Rentnerleben von 20 Jahren summiert sich dieser Unterschied auf mehr als 83.000 €.
Die Schieflage bleibt – trotz Angleichung
Die Rechnung zeigt: Die nominale Angleichung der Rentenberechnung führt nicht automatisch zu gleichen Rentenansprüchen. Der strukturelle Einkommensunterschied zwischen Ost und West bleibt bestehen – und er wird ab Juli 2025 nicht mehr ausgeglichen.
Das bedeutet für viele Menschen im Osten: Sie leisten über Jahrzehnte dieselbe Arbeit, zahlen in dasselbe System ein – und bekommen am Ende spürbar weniger Rente. Die Abschaffung des Umrechnungsfaktors trifft gerade jene hart, deren Einkommen ohnehin unter dem Bundesdurchschnitt liegt.
Was bleibt als Ausweg?
Die individuellen Handlungsspielräume sind begrenzt. Zwar können Erwerbstätige durch längeres Arbeiten, Nebenjobs oder freiwillige Beiträge zusätzliche Entgeltpunkte sammeln. Doch diese Optionen stehen nicht allen offen – und lösen das strukturelle Problem nicht. Die Grundrente hilft ebenfalls nur begrenzt und greift nur bei sehr geringen Rentenansprüchen und langen Versicherungszeiten.
Langfristig kann das Problem nur politisch gelöst werden – etwa durch gezielte Lohnsteigerungen in strukturschwachen Regionen, steuerliche Entlastungen niedriger Einkommen oder ergänzende Vorsorgesysteme.
Eine Reform mit Schlagseite
Die Rentenangleichung ist ein symbolisch wichtiger und verfassungsrechtlich gebotener Schritt. Doch sie zeigt zugleich, wie komplex soziale Gerechtigkeit in der Praxis ist. Eine formale Gleichstellung reicht nicht aus, wenn sie reale Ungleichheit zementiert. Ohne spürbare Einkommensangleichung bleibt für viele Ostdeutsche am Ende der Arbeitsbiografie vor allem eines: ein Rentenbescheid mit einer schmerzlichen Lücke.
Themen:
LESEN SIE AUCH
Sparverhalten 2025: Altersvorsorge legt zu – Konsum und Immobilienwünsche holen auf
Altersvorsorge bleibt wichtigstes Sparziel der Deutschen: Mehr als 60 Prozent der Bürger sparen vorrangig für den Ruhestand – Konsum und Wohneigentum legen ebenfalls zu. Das zeigt eine Umfrage des Verbands der Privaten Bausparkassen.
Freiwillige Rentenbeiträge: Bis 31. März 2025 rückwirkend für 2024 einzahlen
Wer noch freiwillige Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung für das Jahr 2024 leisten möchte, hat dafür bis zum 31. März 2025 Zeit. Darauf weist die Deutsche Rentenversicherung Bund hin.
Stabilisierung des Rentenniveaus: Wer verliert und wer gewinnt wirklich?
Neue Berechnungen zeigen: Eine langfristige Stabilisierung des Rentenniveaus hätte für nahezu alle Geburtsjahrgänge zwischen den 1940ern und 2010 eine höhere Rendite der gesetzlichen Rente bedeutet. Besonders profitieren Versicherte aus den Jahrgängen 1960 bis 1980.
Individuelle Rentenlücke wird unterschätzt
Rente, Rentensicherheit und Rentenhöhe sind Dauerthemen in der politischen und gesellschaftlichen Diskussion. Doch ist den heute Erwerbstätigen bewusst, was ihnen im Ruhestand tatsächlich zur Verfügung stehen wird? 49 Prozent der unter 35-Jährigen und 47 Prozent der über 55-Jährigen rechnen für die Rente mit maximal 1.000 Euro weniger im Portemonnaie. Gleichzeitig sagen sie auch, dass sie finanziell nicht mehr für den Ruhestand vorsorgen können.
Unsere Themen im Überblick
Themenwelt
Wirtschaft
Management
Recht
Finanzen
Assekuranz
„Die Pflegeversicherung war als Teilkasko gedacht – heute wird sie wie eine Vollkasko beansprucht“
Wie lässt sich eine zukunftsfähige Altersvorsorge gestalten, die auch den wachsenden Pflegebedarf berücksichtigt? Diese Frage stand im Zentrum der Jahrestagung der DAV und DGVFM. Der Rückblick im Verbandsmagazin Aktuar zeigt: An klaren Analysen mangelt es nicht.
Rentenwert 2025: 66 Euro mehr im Monat – Renten steigen zum 1. Juli deutlich
Der Bundesrat hat der Rentenwertbestimmungsverordnung 2025 vergangenen Freitag zugestimmt. Das bedeutet auch ein Rentenplus für Landwirte. Zudem wurden höhere Pflegegeldgrenzen in der Unfallversicherung vereinbart.
Rentenwelle der Babyboomer: Jeder Fünfte geht vorzeitig in den Ruhestand
Die Frühverrentung der Babyboomer belastet das Rentensystem deutlich, warnt das Institut der deutschen Wirtschaft (IW). Eine neue Auswertung zeigt, dass zum Jahresende 2023 bereits 900.000 Personen aus den Geburtsjahrgängen 1958 bis 1969 eine gesetzliche Altersrente bezogen – ohne das gesetzliche Rentenalter erreicht zu haben. Bei den älteren Babyboomern (Jahrgänge 1954 bis 1957) lag die Frühverrentungsquote sogar bei 44 Prozent.
Frühstartrente: „Zehn Euro sind ein gutes Signal – mehr aber auch nicht“
Die Frühstart- und Aktivrente der neuen Bundesregierung wird von Plansecur grundsätzlich begrüßt – doch Geschäftsführer Heiko Hauser warnt: Für eine auskömmliche Altersvorsorge reicht das Modell keinesfalls. Finanzbildung müsse daher früh in der Schule ansetzen.
Die neue Ausgabe kostenlos im Kiosk
Werfen Sie einen Blick in die aktuelle Ausgabe und überzeugen Sie sich selbst vom ExpertenReport. Spannende Titelstories, fundierte Analysen und hochwertige Gestaltung – unser Magazin gibt es auch digital im Kiosk.