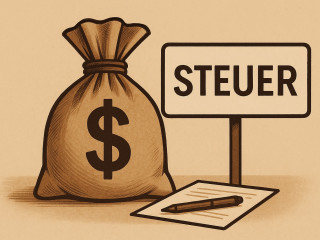Photo credit: depositphotos.com
Die Aussichten für die Wirtschaft in der Eurozone bleiben im Jahr 2024 eher trüb. Niedrige Verbraucherausgaben, schwächere Industriekonjunktur, Inflation und hohe Zinsen dämpfen die Aussichten auf eine wirtschaftliche Erholung.
„Durch die Eurozone weht angesichts der wirtschaftlichen Unwägbarkeiten 2024 ein rauer Wind der Unsicherheit“, sagt Frank Liebold, Country Director Deutschland beim internationalen Kreditversicherer Atradius. Das verarbeitende Gewerbe hat in der Eurozone und Deutschland mit einer gedämpften Auslandsnachfrage und strengeren finanziellen Bedingungen zu kämpfen, die sich zunehmend negativ auf Investitionen und Verbraucherausgaben auswirken. Auch der Dienstleistungssektor schwächt sich weiter ab.
Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die schwächere Industriekonjunktur auf andere Sektoren übergreift, der Wachstumsschub durch die Wiedereröffnung nach der Pandemie nachlässt und die Auswirkungen der höheren Zinssätze sich ausweiten.
Die jüngste Prognose von Atradius geht von einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,5 Prozent im Jahr 2023 aus, das sind 0,1 Prozentpunkte weniger als vor sechs Monaten. Die Wachstumsprognose für den Euroraum für 2024 wurde ebenfalls nach unten korrigiert, wobei das BIP-Wachstum mit 0,6 Prozent unter der Erwartung von vor sechs Monaten liegen dürfte.Für 2024 wurde das Wachstum aller großen Volkswirtschaften nach unten revidiert, für Deutschland wird ein Negativwachstum von minus 0,1 Prozent erwartet. Frank Liebold stellt fest:
Das Schrumpfen der deutschen Wirtschaft ist alarmierend.
Wie angespannt die Stimmung bereits in der Industrie ist, zeigt auch die jüngste Umfrage von Atradius unter mehr als 480 deutschen Unternehmen. Demnach erwarten 54 Prozent der befragten Firmen eine Stagnation der Konjunktur und 34 Prozent gar eine Rezession.
Lediglich zwölf Prozent der Unternehmen rechnen mit einer Erholung. Als größte Herausforderungen sieht die deutsche Wirtschaft nach wie vor die anhaltend hohen Energiekosten, den Fachkräftemangel, die Inflation, die geopolitischen Entwicklungen sowie die schwache Konjunktur. Eine pessimistische Stimmung zeichneten zuletzt auch wichtige internationale Konjunkturindikatoren wie der Europäische Stimmungsindikator ESI oder der Einkaufsmanagerindex PMI.
Investitionen tragen wenig zum Wachstum bei
Immerhin: Das Wachstum der Unternehmensinvestitionen nahm zuletzt zu, ist aber aufgrund der restriktiven Geldpolitik nach wie vor gering. Starke Bilanzen helfen den Unternehmen bei der Umstellung auf eine energiesparende und emissionsärmere Produktion. Auch die Lockerung von Engpässen in der Lieferkette dürfte Investitionen stützen.
Die Infrastrukturinvestitionen haben auch von öffentlichen Ausgaben und nicht zuletzt von EU-Finanzierungspaketen profitiert. Die Wohnungsbauinvestitionen entwickeln sich weniger gut, da die Straffung der Geldpolitik und die hohen Inputkosten diesen Sektor belasten. „Wir erwarten, dass der Wohnungsbau das Wachstum der Gesamtinvestitionen weiterhin bremsen wird, allerdings mit abnehmender Tendenz“, so Frank Liebold weiter.
Inflation geht weiter zurück
Die Inflation in der Eurozone ging im November auf 2,4 Prozent zurück, was einem Rückgang von 0,5 Prozentpunkten gegenüber dem Vormonat entspricht. Die Kerninflation ging um 0,6 Prozentpunkte auf 3,6 Prozent zurück. Die Inflationskomponenten Energie und Nahrungsmittel gehen aufgrund von günstigen Basiseffekten rasch zurück, da die starken Preissteigerungen des letzten Jahres allmählich aus den jährlichen Inflationsraten herausfallen. Aber auch die Komponenten der Kerninflation – Industriegüter und Dienstleistungen ohne Energie – begannen in den letzten Monaten zu sinken. Die Gesamtinflation (VPI) wird den Schätzungen zufolge weiter sinken.
Die geldpolitische Straffung pausiert
Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) geht davon aus, dass die Zinssätze ein Niveau erreicht haben, das, wenn es lange genug beibehalten wird, die Inflation auf das Zielniveau zurückführt. Nach einer Anhebung der Leitzinsen um 25 Basispunkte im September ließ die EZB ihre Leitzinsen bis Dezember unverändert.
Seit Juli 2022 hatte sie ihre Leitzinsen um 450 Basispunkte angehoben. Der Einlagensatz liegt derzeit bei 4,0 Prozent „Dies bedeutet, dass der Endsatz erreicht ist und die Zinssätze auf den kommenden Sitzungen der EZB stabil bleiben werden“, schätzt Frank Liebold. Die Inflationszahlen scheinen die Ansicht der EZB zu bestätigen, dass eine Pause bei den Zinserhöhungen gerechtfertigt ist.
Jüngste Daten zeigen auch, dass die Straffung der Geldpolitik Auswirkungen auf die Verfügbarkeit von Krediten hat. Eine EZB-Umfrage zur Kreditvergabe im vierten Quartal deutete erneut auf eine Verschärfung der Kreditstandards für Unternehmenskredite hin (der Nettoanteil der Banken, die eine Verschärfung meldeten, lag bei zwölf Prozent). Auch bei Verbraucherkrediten und Hypothekarkrediten meldeten die Banken eine weitere Verschärfung ihrer Kreditstandards.
Die verschärfte Risikowahrnehmung und die geringere Risikotoleranz der Banken hatten weiterhin den größten Einfluss auf die Verschärfung. Die Daten zur Kreditvergabe der Banken sind ebenfalls schwach, wobei sich das Wachstum der Bankkredite für Unternehmen und für private Haushalte verlangsamte.
„Eine Verschärfung der Geldpolitik führt unweigerlich zu strengeren Kreditstandards und verminderter Risikobereitschaft der Banken. Dies spiegelt sich in der verlangsamten Kreditvergabe sowohl an Unternehmen als auch an private Haushalte wider, was die Wirtschaft insgesamt beeinträchtigt“, so Frank Liebold.
Themen:
LESEN SIE AUCH
Geldpolitik: Aktuell kein Handlungsdruck für die EZB
Die EZB fährt einen riskanten Kurs. Um die Inflation einzudämmen, hat sie die Leitzinsen mehrfach deutlich erhöht. Das gefährdet Konjunktur, Beschäftigung und Klimaziele. Weitere Erhöhungen – wie angekündigt - bergen angesichts der Trends bei der Preisentwicklung eher unnötig Risiken.
Bundesbank mit Rekordverlust: 19,2 Milliarden Euro Minus im Jahr 2024
Die Deutsche Bundesbank hat das Geschäftsjahr 2024 mit einem historischen Defizit abgeschlossen. Mit 19,2 Milliarden Euro Verlust verzeichnet sie das höchste Minus ihrer Geschichte – und den ersten Fehlbetrag seit 1979.
Weltwirtschaft im Umbruch: Handelskonflikte, Zinsentscheidungen und wirtschaftliche Unsicherheiten
Die globale Wirtschaft steht Anfang 2025 vor großen Herausforderungen. Während die USA und China ihr Wachstum behaupten, stagniert die Wirtschaft im Euroraum.
Deutsche Wirtschaft: Zwischen Hoffnung und Skepsis
Mit Blick auf den privaten Konsum sollte die steigende Kaufkraft der Haushalte zu einem spürbaren Anstieg der privaten Ausgaben führen. Die Exportwirtschaft leidet aber weiter unter globaler Nachfrageschwäche. So verstetigt sich ein schlechtes Konsumklima trotz wachsender Realeinkommen.
Unsere Themen im Überblick
Themenwelt
Wirtschaft
Management
Recht
Finanzen
Assekuranz
Fiskalische Zeitenwende oder riskante Halse? Deutschlands Investitions- und Verteidigungskurs im Stresstest
Deutschland steht vor einem wirtschafts- und sicherheitspolitischen Kraftakt historischen Ausmaßes. Mit einem 500-Milliarden-Euro-Investitionspaket und dem Ziel, die Verteidigungsausgaben auf 3,5 % des BIP zu steigern, wagt die Bundesregierung eine fiskalische Zeitenwende. Doch der Spagat zwischen Wachstumsimpulsen, geopolitischer Abschreckung und haushaltspolitischer Stabilität ist riskant – ökonomisch wie gesellschaftlich.
Stromsteuer-Senkung bleibt aus: Verbraucher außen vor
Die Bundesregierung verabschiedet sich von ihrem Versprechen, die Stromsteuer für alle Verbraucher auf das EU-Mindestmaß zu senken. Nur Industrie und Landwirtschaft sollen entlastet werden. Während Ministerin Reiche von „finanzieller Wirklichkeit“ spricht, wirft der Steuerzahlerbund der Regierung einen Wortbruch vor. Die Entscheidung trifft besonders Mittelstand und Haushalte – und beschädigt die politische Glaubwürdigkeit der Ampel.
Ertragsteuern im Rückwärtsgang – aber Lohn- und Umsatzsteuer stabilisieren die Einnahmelage
Wie das Bundesfinanzministerium im Monatsbericht Juni 2025 mitteilt, hat sich das Steueraufkommen im Mai weiter positiv entwickelt – mit einer wichtigen Ausnahme: Die Ertragsteuern geraten spürbar unter Druck. Während Lohn- und Umsatzsteuer verlässlich tragen, wirft der Rückgang bei den ertragsbezogenen Einnahmen Fragen nach der konjunkturellen Substanz auf.
Krisenzeiten hinterlassen Spuren: Finanzielle Engpässe vor allem bei älteren Verbrauchergruppen
Trotz wirtschaftlicher Erholung nach der Corona-Pandemie und dem Beginn des Ukraine-Kriegs bleibt die finanzielle Lage vieler Haushalte angespannt. Welche Verbraucher-Gruppen besonders betroffen sind.
Die neue Ausgabe kostenlos im Kiosk
Werfen Sie einen Blick in die aktuelle Ausgabe und überzeugen Sie sich selbst vom ExpertenReport. Spannende Titelstories, fundierte Analysen und hochwertige Gestaltung – unser Magazin gibt es auch digital im Kiosk.