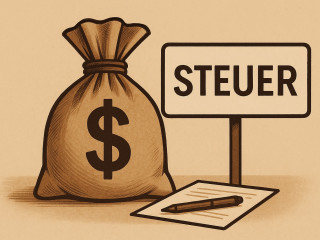Die große Sorge vor einer Energienotlag ist jetzt, am Ende des Jahres 2023 und mit Blick auf den bevorstehenden Winter kein Thema mehr. Dennoch ist die wirtschaftliche Lage in Deutschland nur scheinbar besser als im Vorjahr. Tatsächlich lag die Wirtschaftsleistung im Q3 2023 ziemlich exakt auf dem Niveau vom Jahresende 2022. Aktuelle Konjunkturindikatoren weisen auf eine anhaltende Stagnation hin, was die Notwendigkeit politischer und wirtschaftlicher Anpassungen unterstreicht.
Ein Beitrag von Axel D. Angermann, Chef-Volkswirt der FERI Gruppe
Die Aussichten für das Jahr 2024 bleiben insgesamt getrübt. Ein wesentlicher Grund dafür sind hohe Unsicherheiten über die weitere Entwicklung der Weltwirtschaft. Die schwache Nachfrage aus den Schlüsselmärkten USA und China begrenzt die Exportaussichten der deutschen Unternehmen. Eine Trendwende ist hier nicht in Sicht.
Aus China sind weiterhin kaum positive Impulse zu erwarten, und der US-Wirtschaft droht im kommenden Jahr eine moderate Rezession, mindestens aber eine deutliche Abschwächung der Wachstumsdynamik. Wenn die Ausfuhr in die beiden wichtigsten Handelspartner außerhalb der EU schwächelt, ist das kein gutes Vorzeichen für die Exporte insgesamt.
Inlandsmarkt unter Zinsdruck
Die restriktive Geldpolitik der Europäischen Zentralbank wirkt sich zunehmend negativ auf den Inlandsmarkt aus. Zwar ist der Anteil der Unternehmen, die Finanzierungsengpässe als wesentliches Produktionshemmnis ansehen, nach wie vor gering. Dafür klagen aber inzwischen fast 40 Prozent der Industrieunternehmen unter Auftragsmangel, und zusammen mit deutlich gestiegenen Zinsen ist das keine gute Voraussetzung für höhere Ausrüstungsinvestitionen.
Im Bausektor federn die bestehenden Aufträge im Tiefbau und im Gebäudebestand die Rückgänge in anderen Bereichen noch ab, aber der Rückgang der Wohnungsbaugenehmigungen um mehr als 30 Prozent, die nahezu halbierten Wohnungsbaukredite an Haushalte und der deutlich sinkende Umsatz von Bauträgern und Projektentwicklern lassen für die Bauinvestitionen insgesamt nichts Gutes erwarten.
Verunsicherung bremst den privaten Konsum
Mit Blick auf den privaten Konsum sollte die steigende Kaufkraft der Haushalte aufgrund der nachlassenden Inflation zu einem spürbaren Anstieg der privaten Ausgaben führen. Dem steht allerdings eine anhaltend sehr schlechte Konsumentenstimmung entgegen, die deutlich unter dem Niveau vom Frühjahr 2020 zu Beginn der Corona-Pandemie liegt.
Nachdem das Bundesverfassungsgericht festgestellt hat, dass die Pläne der Ampel-Regierung zur Finanzierung des Klima- und Transformationsfonds gegen die Verfassung verstoßen, stehen nicht nur zahlreiche Projekte im Rahmen der geplanten Energiewende auf der Kippe. Es herrscht nun auch generell verstärkte Unsicherheit über die Entwicklung von Steuern und das Weiterbestehen von Subventionen. All das lähmt die Ausgabenlust der privaten Haushalte. Auch der staatliche Konsum wird unter der verhängten Haushaltssperre leiden.
Die Regierung ist gefordert
Für 2024 ist nur mit einem marginalen Anstieg der Wirtschaftsleistung zu rechnen. Deutschland droht damit in einen verhängnisvollen Kreislauf zu geraten: Die dann seit fünf Jahren andauernde Wirtschaftsflaute verschärft bestehende Verteilungskonflikte und bremst die Möglichkeiten zur finanziellen Abfederung notwendiger Strukturanpassungen, und dies wiederum bremst die wirtschaftliche Dynamik weiter. Es bleibt zu hoffen, dass die Ampel-Regierung noch die Kraft findet, mittels einer systematischen Verbesserung der allgemeinen Rahmenbedingungen und der Streichung nicht notwendiger Staatsausgaben diesen Knoten zu durchschlagen.
Themen:
LESEN SIE AUCH
Deutsche Wirtschaft hat Talsohle noch nicht durchschritten
Nachdem das BIP im letzten Quartal 2022 um 0,4 Prozent geschrumpft ist, prognostiziert das DIW Berlin auch für das laufende erste Quartal einen erneuten leichten Rückgang der Wirtschaftsleistung. Ab dem Q2 ist dann von zunehmend positiven Raten auszugehen.
Konjunktur zwischen Stagflation und Rezession
Stark steigende Lebenshaltungskosten und Energiepreise dämpfen die Konjunktur, die durch den Nachholbedarf an Dienstleistungen zustande kam. Bis zum Frühjahr 2023 wird ein leicht negatives Wachstum erwartet, das erst ab Frühjahr 2023 in einem moderaten Wachstumspfad mündet.
Eine Rezession ist noch nicht in Sicht
Weltwirtschaft im Umbruch: Handelskonflikte, Zinsentscheidungen und wirtschaftliche Unsicherheiten
Die globale Wirtschaft steht Anfang 2025 vor großen Herausforderungen. Während die USA und China ihr Wachstum behaupten, stagniert die Wirtschaft im Euroraum.
Unsere Themen im Überblick
Themenwelt
Wirtschaft
Management
Recht
Finanzen
Assekuranz
Mindestlohn steigt bis 2027 auf 14,60 Euro – Kommission warnt vor politischer Einflussnahme
Der gesetzliche Mindestlohn soll in zwei Stufen auf 14,60 Euro pro Stunde angehoben werden. Der einstimmige Beschluss der Mindestlohnkommission sorgt für politische und wirtschaftliche Debatten – zwischen sozialem Anspruch und wirtschaftlicher Tragfähigkeit.
Fiskalische Zeitenwende oder riskante Halse? Deutschlands Investitions- und Verteidigungskurs im Stresstest
Deutschland steht vor einem wirtschafts- und sicherheitspolitischen Kraftakt historischen Ausmaßes. Mit einem 500-Milliarden-Euro-Investitionspaket und dem Ziel, die Verteidigungsausgaben auf 3,5 % des BIP zu steigern, wagt die Bundesregierung eine fiskalische Zeitenwende. Doch der Spagat zwischen Wachstumsimpulsen, geopolitischer Abschreckung und haushaltspolitischer Stabilität ist riskant – ökonomisch wie gesellschaftlich.
Stromsteuer-Senkung bleibt aus: Verbraucher außen vor
Die Bundesregierung verabschiedet sich von ihrem Versprechen, die Stromsteuer für alle Verbraucher auf das EU-Mindestmaß zu senken. Nur Industrie und Landwirtschaft sollen entlastet werden. Während Ministerin Reiche von „finanzieller Wirklichkeit“ spricht, wirft der Steuerzahlerbund der Regierung einen Wortbruch vor. Die Entscheidung trifft besonders Mittelstand und Haushalte – und beschädigt die politische Glaubwürdigkeit der Ampel.
Ertragsteuern im Rückwärtsgang – aber Lohn- und Umsatzsteuer stabilisieren die Einnahmelage
Wie das Bundesfinanzministerium im Monatsbericht Juni 2025 mitteilt, hat sich das Steueraufkommen im Mai weiter positiv entwickelt – mit einer wichtigen Ausnahme: Die Ertragsteuern geraten spürbar unter Druck. Während Lohn- und Umsatzsteuer verlässlich tragen, wirft der Rückgang bei den ertragsbezogenen Einnahmen Fragen nach der konjunkturellen Substanz auf.
Die neue Ausgabe kostenlos im Kiosk
Werfen Sie einen Blick in die aktuelle Ausgabe und überzeugen Sie sich selbst vom ExpertenReport. Spannende Titelstories, fundierte Analysen und hochwertige Gestaltung – unser Magazin gibt es auch digital im Kiosk.