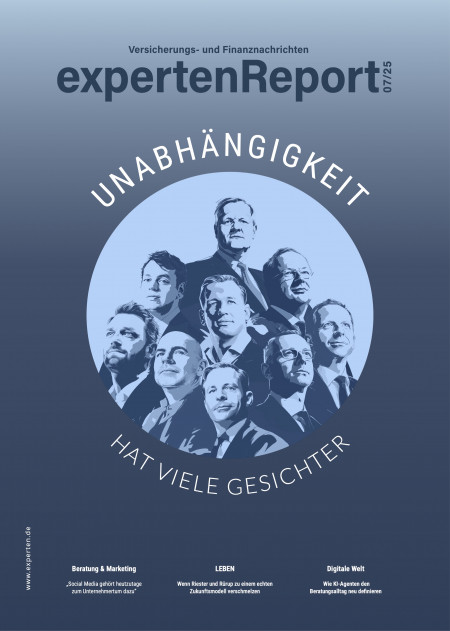Das Entgelttransparenzgesetz soll die Benachteiligung von Frauen beseitigen. Doch es entfaltet bislang nur wenig Wirkung. Zwar haben im Zeitraum von 2019 bis 2021 in mehr Betrieben Beschäftigte ihren individuellen Auskunftsanspruch genutzt als im Vergleichszeitraum kurz nach Inkrafttreten des Gesetzes 2018. Allerdings ist der Anteil der Betriebe, in denen mindestens eine Auskunftsanfrage gestellt wurde, mit gut einem Viertel bei mitbestimmten Betrieben der Privatwirtschaft und etwa zehn Prozent im Öffentlichen Dienst weiter niedrig.
Nur bei knapp der Hälfte der Betriebe in Unternehmen ab 501 Beschäftigten und mit Betriebsrat haben bislang die Arbeitgeber die gesetzliche Aufforderung umgesetzt, die Entgelte von Frauen und Männern auf Ungleichheit zu prüfen.
Dabei spielt die betriebliche Mitbestimmung ganz offensichtlich eine positive Rolle. Denn Betriebe tun beispielsweise deutlich mehr, wenn es Betriebsvereinbarungen zu Gleichstellung oder verwandten Themen zwischen Management und Betriebsrat gibt und wenn das Verhältnis von Betriebsrat und Geschäftsführung generell gut ist.
Es ist daher wahrscheinlich, dass die Situation in Betrieben ohne Betriebsräte und effektive Mitbestimmung noch deutlich schlechter ist. Das ergibt eine neue Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung. 1
Um die bislang geringe Wirkung des Entgelttransparenzgesetz zu erhöhen, sind strengere Auflagen, spürbare Sanktionen sowie niedrigere Hürden bei der Wahrnehmung des Transparenzanspruchs nötig, schreiben die Forschenden Dr. Helge Emmler und Dr. Christina Klenner. Die neue EU-Richtlinie zur Lohntransparenz – kürzlich beschlossen, aber noch nicht in Kraft getreten – sei sinnvoll, um der im Koalitionsvertrag der Bundesregierung vorgesehenen Reform für ein wirksameres Gesetz Schub zu geben. „Gerade in Deutschland mit seinem hohen Gender Pay Gap erscheint das dringlich“, so Emmler und Klenner.
Frauen müssen im gleichen Betrieb für gleiche und gleichwertige Arbeit den gleichen Lohn erhalten wie Männer. Diesen Grundsatz soll das seit Mitte 2017 geltende Entgelttransparenzgesetz fördern. In Betrieben mit mehr als 200 Beschäftigten – also für etwa ein Drittel aller Arbeitnehmer*innen in Deutschland – gilt ein „individueller Auskunftsanspruch“, der in einem zweiten Schritt Anfang 2018 in Kraft getreten ist.
Offenlegung von Ungerechtigkeiten
Danach können Beschäftigte verlangen, dass ihnen der Arbeitgeber das durchschnittliche Gehalt der Kolleginnen oder Kollegen des jeweils anderen Geschlechts nennt, die eine ähnliche Arbeit leisten. Dadurch sollen bestehende Ungerechtigkeiten offengelegt und schließlich beseitigt werden.
Für privatwirtschaftliche Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten gelten weitere Vorgaben: Dort soll der Arbeitgeber regelmäßig überprüfen, wie es um die Entgeltgleichheit im Unternehmen steht. Diese Aufforderung gilt nicht für den Öffentlichen Dienst. Generell sieht das Gesetz keine Sanktionen bei Nichtbefolgung vor.
Wie es um die betriebliche Umsetzung des Entgelttransparenzgesetzes steht, haben Emmler und Klenner auf Basis der WSI-Betriebs- und Personalrätebefragung 2021 analysiert. Die Befragung unter Mitgliedern von knapp 3900 Betriebs- und Personalräten ist repräsentativ für Betriebe mit Betriebsrat und mindestens 20 Beschäftigten. Die Forschenden vergleichen die Befunde aus 2021 mit denen aus der vorausgegangenen Befragungswelle im Jahr 2018. Damals wurden Betriebs-, aber keine Personalräte befragt.
Entscheidende Rolle der Betriebsräte
Auf Basis der Betriebsrätebefragung können die Forschenden natürlich keinen direkten Vergleich mit der Situation in Betrieben ohne Mitbestimmung anstellen. Doch die Befragungsergebnisse zeigen: Aktive, für Geschlechterungerechtigkeiten sensibilisierte Betriebsräte sind ein wichtiger positiver Faktor bei der Umsetzung des Entgelttransparenzgesetzes.
Das Gesetz wird signifikant häufiger umgesetzt in Betrieben, in denen Betriebsrat und Management Betriebsvereinbarungen (BV) zu Themen wie Antidiskriminierung oder Gleichstellung der Geschlechter abgeschlossen haben (knapp 59 Prozent gegenüber knapp 42 Prozent ohne BV). Das legt nach Analyse der Forschenden nahe, „dass die Betriebsräte eine sehr wichtige Rolle bei der Umsetzung des Entgelttransparenzgesetzes spielen können.“ Dazu bräuchten sie aber auch angemessene Ressourcen, beispielsweise zusätzliche Freistellungen.
Weitere Kernergebnisse
In der Mehrheit der privaten Betriebe mit Betriebsrat, in denen Beschäftigte den gesetzlichen Auskunftsanspruch haben, hat zwischen 2019 und 2021 niemand diesen Anspruch genutzt. Allerdings ist der Anteil der Betriebe, in denen mindestens ein*e Beschäftigte*r Auskunft begehrte, gestiegen: von 17 Prozent 2018 auf nun 26 Prozent.
Im öffentlichen Dienst berichten nur zehn Prozent der befragten Personalräte, dass Beschäftigte ihrer Dienststelle Anfragen zur Überprüfung ihres Entgelts gestellt haben.
Eine betriebliche Prüfung der Entgelte von Frauen und Männern auf Ungleichheit durch den Arbeitgeber wurde nach Angaben der Betriebsräte in rund 49 Prozent aller Betriebe durchgeführt. Das ist zwar spürbar mehr als 2018, als das nur für knapp 37 Prozent der Betriebe galt, gleichwohl weiterhin die Minderheit. Zudem lässt sich mit der Befragung nicht klären, ob die Prüfung aussagekräftig, umfangreich und systematisch oder nur oberflächlich war, betonen Klenner und Emmler.
Die Instrumente des Gesetzes werden häufiger genutzt, wenn im Betrieb der Anteil von hochqualifizierten und/oder von jungen Beschäftigten überdurchschnittlich ist.
Verpflichtende Gehaltsstrukturen
Auf Basis ihrer Untersuchung halten Emmler und Klenner die politischen Initiativen für sehr wichtig, das Entgelttransparenzgesetz wirksamer und verbindlicher auszugestalten. Dazu gehört für die Forschenden, die Prüfung der betrieblichen Gehaltsstrukturen nicht nur zu empfehlen, sondern verpflichtend zu machen und dabei valide Prüfungsverfahren vorzuschreiben, für die es mittlerweile auch Zertifizierungen gibt.
Zweitens müsse der individuelle Auskunftsanspruch künftig auch für Beschäftigte in kleineren Betrieben gelten. Heute hohe Hürden für dessen Durchsetzung müssten abgesenkt werden, etwa durch die Möglichkeit zu Sammelklagen und ein Verbandsklagerecht. Für Verstöße gegen die gesetzlichen Verpflichtungen müsse ein novelliertes Gesetz wirksame Sanktionen vorsehen, die es bisher überhaupt nicht gebe.
Anmerkungen:
1 Helge Emmler, Christina Klenner: Wie wird das Entgelttransparenzgesetz in Betrieben umgesetzt? Antworten Betriebs- und Personalräte 2021, WSI-Report Nr. 84, Mai 2023. Download: https://www.boeckler.de/de/faust-detail.htm?sync_id=HBS-008620
Themen:
LESEN SIE AUCH
Traditionelle Strukturen bremsen die Gleichstellung
Minijobs in Zeiten von Corona und Krisen
Weniger Zukunftsängste, aber soziale Ungleichheit verschärft sich
2,7 Millionen verdienen weniger als Mindestlohn
Unsere Themen im Überblick
Themenwelt
Wirtschaft
Management
Recht
Finanzen
Assekuranz
Freiwilliger Wehrdienst: Wann trotzdem Kindergeld gezahlt wird
PKV: Dürfen Geschlechtsangleichungen ausgeschlossen werden?
KI-Regulierung in der Praxis: AfW veröffentlicht Leitfaden für Vermittler
Ostseehochwasser: Verbraucherschützer planen Musterklage gegen Versicherer
Die neue Ausgabe kostenlos im Kiosk
Werfen Sie einen Blick in die aktuelle Ausgabe und überzeugen Sie sich selbst vom ExpertenReport. Spannende Titelstories, fundierte Analysen und hochwertige Gestaltung – unser Magazin gibt es auch digital im Kiosk.