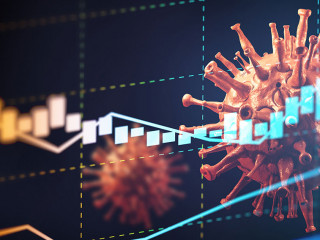Neue DIA-Studie untersucht die Dimensionen der Betroffenheit durch Corona. Die Themen der repräsentativen Befragung waren Konsumausgaben/Sparen, Homeoffice sowie die Wohnsituation.
Jeder Fünfte in Deutschland (19 Prozent) war von der Corona-Pandemie finanziell ganz erheblich betroffen. So hatten acht Prozent hohe Einkommensverluste zu verkraften (mehr als 500 Euro pro Monat). Elf Prozent mussten finanzielle Mittel mobilisieren, also zum Beispiel einen Antrag auf Sozialleistungen stellen, ein Darlehen aufnehmen oder Ersparnisse aufbrauchen. Ein weiteres knappes Fünftel (17 Prozent) hatte zwar keine finanziellen Probleme, musste aber pandemiebedingt im Homeoffice arbeiten. Für drei Fünftel dagegen änderte Corona bei Einkommen und Beruf nichts. Zu dieser Einschätzung der beruflich-finanziellen Betroffenheit kommt die jüngste Studie des Deutschen Instituts für Altersvorsorge (DIA). Nach zwei Jahren Pandemie ermöglicht diese Studie eine Aussage über die Dimensionen der Betroffenheit durch die mit Corona verbundenen Be- und Einschränkungen.
Sozio-ökonomische Corona-Betroffenheit
Die Untersuchung beruht auf einer umfangreichen Befragung, die im vergangenen Jahr vom Meinungsforschungsinstitut INSA Cosulere durchgeführt wurde. Die darauf aufbauenden typbezogenen Tiefeninterviews und die Auswertungen verantwortete ein Expertenteam des Berliner Forschungs- und Beratungsunternehmens empirica. Es entwickelte auf der Grundlage der erhobenen Daten Steckbriefe der sozio-ökonomischen Corona-Betroffenheit. Dafür fassten die Experten die kleineren Gruppen mit hohen Einkommensverlusten und finanzieller Mobilisierung zur Gruppe der „Corona-Verlierer“ zusammen und verschnitten diese Dimension mit dem Alter und Bildungsstatus. So ergaben sich drei Hauptgruppen der sozio-ökonomischen Betroffenheit (Ungeschorene, Angekratzte, Geschorene) mit zwei Teilgruppen. Anhand dieser Einteilung wurden die Themen „Konsumausgaben/Sparen“, „Ausbreitung Homeoffice“ und „Wohnsituation“ untersucht.
Einige Ergebnisse im Überblick: Die Älteren sind weitestgehend ungeschoren durch die Krise gekommen. Das trifft auch auf unterdurchschnittlich Verdienende und Arbeitnehmer mit geringem Bildungsabschluss zu. Gutverdiener, Urbane und Akademiker waren zwar oft im Homeoffice, hatten aber keine finanziellen Einbußen. Im Gegenteil: Mangels Konsumgelegenheit sparten sie oft sogar mehr als vorher. Die Geschorenen wiederum sind einerseits Selbstständige und Freiberufler zum Beispiel in der Gastronomie und im Messebau und andererseits die Einkommensschwächsten. Nach Mutmaßung der Studienautoren vorwiegend Aushilfskräfte und 450-Euro-Jobber mit einfacher Dienstleistungstätigkeit.
Pandemie verändert das Sicherheitsbewusstsein
Rücklagen aus eingeschränkten Konsummöglichkeiten während der Lockdowns will die Mehrheit größtenteils noch ausgeben. „Offenbar wirken hier erhebliche Nachholeffekte. Man will den verpassten Urlaub oder Restaurantbesuch nachholen und sich schlicht mal wieder etwas gönnen“, erklärt Studienautor Reiner Braun. Aber selbst wenn das unabsichtlich Gesparte eher ausgegeben wird, hat sich seiner Meinung nach das Sicherheitsbewusstsein verändert. So wollen die Geschorenen eine größere Vorsichtskasse in konservativen Geldanlagen halten. Angekratzte wiederum planen mehr langfristiges Sparen in Aktien und ETF. Durch die Erfahrungen in der Pandemie haben finanzielle Polster für viele offenkundig einen größeren Stellenwert bekommen. Außerdem gibt es Anzeichen dafür, dass das Vertrauen ins Wertpapiersparen bei den Deutschen mit Corona spürbar gewachsen ist.
Ausgeprägter Wunsch, weiterhin im Homeoffice zu arbeiten
Vor allem jüngere, besser Ausgebildete und gut Verdienende waren wegen Corona erstmalig im Homeoffice beschäftigt. Darunter auch viele Städter, die eher beengt auf der Etage wohnen. Am Gros der Erwerbstätigen – und damit insbesondere an Handwerkern, Arbeitern und Geringverdienern – ging diese Spielart der Pandemie vorüber. Dennoch dürfte sie langfristig Auswirkungen auf die künftige Gestaltung des Arbeitsumfeldes haben. So ist der Wunsch, auch weiterhin im Homeoffice zu bleiben, sehr stark ausgeprägt. Das gilt insbesondere für Jüngere, in ländlicher Wohngegend und für Frauen. Bei Frauen dürfte die Familienarbeit ein wichtiges Motiv sein, auf dem Land die gesparten Pendelzeiten und -kosten. Letzteren dürfte jedoch der Arbeitgeber diesem Wunsch seltener erfüllen – so lautet zumindest die Erwartung der befragten Arbeitnehmer außerhalb der Städte. Bei Frauen wiederum ergeben sich Einschränkungen, weil sie eher Berufe haben, die man vor Ort ausüben muss.
Der DIA-Studie mit dem Titel „Gibt es Long Covid beim Sparen und Wohnen?“ liegen empirische Daten aus einer Repräsentativbefragung zugrunde, die im Frühjahr 2021 unter 1.006 Personen stattfand. Aufbauend auf die daraus abgeleitete Typologie wählten die Studienautoren Haushalte für Tiefeninterviews aus. In den Tiefeninterviews im August 2021 erfragten sie dann Details zum jeweiligen Entscheidungshintergrund. Weitere Informationen zur Studie finden Sie hier.
Themen:
LESEN SIE AUCH
Geringverdiener sind bei aktienbasierten Geldanlagen benachteiligt
Neue Entwicklungen bringen frischen Wind in Covid-Markt
Sparwille sinkt im Jahresverlauf 2021 signifikant
Finanzielle Lage verschärft sich bei jungen Geringverdienern
Unsere Themen im Überblick
Themenwelt
Wirtschaft
Management
Recht
Finanzen
Assekuranz
Lebensversicherung: ZZR-Rückflüsse bringen Spielraum
Zinsanstieg, ZZR-Rückflüsse und demografischer Wandel verändern das Geschäftsmodell der Lebensversicherer grundlegend. Die Branche steht finanziell stabil da – doch das Neugeschäft bleibt unter Druck.
Wiederanlage im Bestand: Versicherer verschenken Milliardenpotenzial
In Zeiten stagnierender Neugeschäftszahlen und hoher Leistungsabfüsse rückt der Versicherungsbestand zunehmend in den Fokus strategischer Überlegungen. Das gilt insbesondere für die Lebensversicherung: Dort schlummern ungenutzte Chancen, die Erträge stabilisieren und die Kundenbindung stärken könnten – wenn Versicherer systematisch auf Wiederanlage setzen würden. Der Text erschien zuerst im expertenReport 05/2025.
#GKVTag – Pflegeversicherung unter Reformdruck: Stabilität durch Solidarität
Drei Jahrzehnte Pflegeversicherung – eine sozialpolitische Erfolgsgeschichte mit strukturellen Rissen. Seit ihrer Einführung garantiert sie die Absicherung pflegebedürftiger Menschen und setzt dabei auf das Zusammenspiel von Solidarität und Eigenverantwortung. Doch mit wachsender Zahl Anspruchsberechtigter, einem Ausgabenvolumen von inzwischen 65 Milliarden Euro und einem Beitragssatz von 3,6 Prozent (zuzüglich Kinderlosenzuschlag) gerät das System an seine finanziellen Grenzen.
„Fünf Tierseuchen gleichzeitig – Tierhalter geraten weiter unter Druck“
Mit einem neuen Höchstwert von 96 Millionen Euro Schadenaufwand blickt die Vereinigte Tierversicherung (VTV) auf das bislang teuerste Jahr ihrer Geschichte zurück. Der Großteil der Schäden entstand durch Tierseuchen – allen voran durch die Blauzungenkrankheit, die allein 30 Millionen Euro kostete. Diese betraf 2024 vor allem Wiederkäuer-Bestände in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Hessen. Die VTV ist Marktführer in der landwirtschaftlichen Tierversicherung und Teil der R+V Gruppe.
Die neue Ausgabe kostenlos im Kiosk
Werfen Sie einen Blick in die aktuelle Ausgabe und überzeugen Sie sich selbst vom ExpertenReport. Spannende Titelstories, fundierte Analysen und hochwertige Gestaltung – unser Magazin gibt es auch digital im Kiosk.