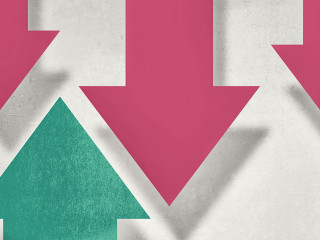Wer zahlt und wer erhält wie viel vom Sozialstaat? Das zeigt das interaktive Tool des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). Differenziert werden die Ergebnisse nach Altersgruppen sowie personenspezifischen Merkmalen wie Geschlecht, Herkunft und Einkommen.
Rund 1,6 Billionen Euro betrugen die deutschen Staatseinnahmen im Jahr 2020. Ein großer Teil dessen entsteht durch Steuern und Abgaben an den Sozialstaat wie Einkommensteuer, Mehrwertsteuer, Renten- und Pflegeversicherungsbeiträge. Hiervon wiederum müssen die Leistungen des Sozialstaats finanziert werden: Dazu zählen beispielsweise Renten, Arbeitslosen- oder Kindergeld, aber auch Sachleistungen wie Bildung oder Gesundheit.
Steuerlast variiert mit dem Alter
Wie viele Abgaben die Deutschen an den Staat zahlen und wie viel sie erhalten, hängt stark vom Alter ab. Kinder und Jugendliche erhalten vor allem Bildungs- und Gesundheitsleistungen. Erst im Erwerbsleben dreht sich die Bilanz allmählich, denn mit dem Erwerbseinkommen steigen Einkommensteuer, Sozialversicherungsbeiträge und weitere Abgaben. Deswegen zahlen erwerbstätige Personen in der Regel mehr an den Staat, als sie an Leistungen beziehen.
Mit Mitte 50 zahlen Deutsche die höchsten Abgaben an den Staat: 20.500 Euro jährlich sind es durchschnittlich, Steuern und Sozialversicherungsbeiträge zusammengerechnet. Mit dem Renteneintritt kehrt sich das Verhältnis von Abgaben und Zahlungen wieder um: Die Deutschen erhalten nun Renten, Pensionen und Leistungen aus dem Gesundheitswesen.
Unterscheidung nach persönlichen Merkmalen
Das IW-Onlinetool zeigt darüber hinaus, wie sich Abgaben und Leistungserhalt anhand persönlicher Merkmale unterscheiden. Unterschieden werden kann nach Geschlecht, Region, Wohnort, Einkommensklasse und Bildung. Auch der demografische Wandel lässt sich anhand des Tools nachvollziehen. Für den Fiskus werde der zu einem rechnerischen Problem, sagt IW-Ökonom Martin Beznoska, der die Werte für das Tool berechnet hat:
Wegen des demografischen Wandels wird es immer dringender, die Sozialsicherungssysteme zu reformieren.
Ab dem 85. Lebensjahr erhalten Deutsche durchschnittlich rund 30.500 Euro jährlich vor allem aus den Sozialversicherungen. Durch die steigende Lebenserwartung steigt jedoch der Anteil älterer Menschen an der Bevölkerung.
Themen:
LESEN SIE AUCH
Rentner arbeiten trotz gutem Auskommen
Midijob-Reform bekämpft Altersarmut zu ungenau
6,2 Mio. Menschen profitieren von der neuen Midijob-Regelung, indem sie weniger in die Rentenversicherung einzahlen müssen und dennoch keine geminderten Rentenansprüche haben. Die Rentenkasse kostet diese Umverteilung 1 Mrd. Euro. Warum diese besser in der Grundrente angelegt wäre.
GKV-Strukturprobleme sind nicht vorübergehend
Das Defizit der Gesetzlichen Krankenversicherung soll mit einem Bündel aus Einzelmaßnahmen für ein Jahr gedeckt werden. Doch die Strukturprobleme der GKV brauchen dringend bessere, langfristig tragfähigere Lösungen, um die nachfolgenden Generationen zu entlasten.
BIP wächst nur um 1,75 Prozent
Unsere Themen im Überblick
Themenwelt
Wirtschaft
Management
Recht
Finanzen
Assekuranz
GKV-Spitzenverband kritisiert Haushaltspläne: Darlehen keine nachhaltige Lösung
Kredite statt Reformen: Der GKV-Spitzenverband kritisiert die Haushaltspläne der Bundesregierung scharf und warnt vor langfristigen Folgen für Beitragszahlende und das Gesundheitssystem.
§ 34k GewO: Neue Regulierung für Ratenkredit-Vermittlung startet 2026
Der neu geschaffene § 34k GewO bringt ab November 2026 weitreichende Pflichten für Vermittler von Ratenkrediten. Der AfW begrüßt das Vorhaben grundsätzlich, warnt jedoch vor unfairen Wettbewerbsbedingungen durch weitgehende Ausnahmen.
„Die Flut an Dokumentationspflichten ist nicht mehr verhältnismäßig“
Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) warnt eindringlich vor den Auswirkungen einer zunehmenden Regulierungsflut in der Versicherungsvermittlung. Im Zentrum der Kritik steht die aus Sicht des Verbands unverhältnismäßige Komplexität gesetzlicher Vorgaben, die nicht nur Vermittler, sondern auch Kunden überfordert – mit negativen Folgen für die Beratungsqualität.
Europas neue Ordnung: Regionalisierung statt Globalismus
In ihrer Kiewer Rede skizziert EZB-Präsidentin Christine Lagarde nicht nur ökonomische Unterstützung für die Ukraine – sie formuliert eine strategische Neuausrichtung Europas: Regionalisierung statt globaler Offenheit. Eine Analyse des leisen, aber folgenreichen Paradigmenwechsels der europäischen Wirtschaftspolitik.
Die neue Ausgabe kostenlos im Kiosk
Werfen Sie einen Blick in die aktuelle Ausgabe und überzeugen Sie sich selbst vom ExpertenReport. Spannende Titelstories, fundierte Analysen und hochwertige Gestaltung – unser Magazin gibt es auch digital im Kiosk.