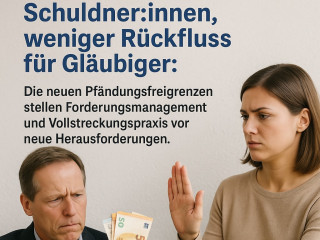Auch in der Hauptversammlungssaison 2023 haben viele Unternehmen auf den persönlichen Kontakt mit ihren Eigentümern verzichtet und Aktionärstreffen virtuell abgehalten. Lediglich 73 der 160 in der DAX-Familie vertretenen Aktiengesellschaften sind nach der Corona-Krise zur Präsenz-Hauptversammlung zurückgekehrt.
Im DAX 40 allein blieben fast 70 Prozent beim virtuellen Format. Nur wenige Unternehmen wichen zugunsten ihrer Aktionäre davon ab. Darunter etwa die Deutsche Telekom, BASF, SAP und Volkswagen. Etwas besser sah es in der zweiten und dritten Reihe aus. Im MDAX war das Verhältnis zwischen Präsenz- und Onlineformat ausgeglichen. Im SDAX überwog die Präsenz-Hauptversammlung mit rund 60 Prozent.
Zudem war die Hauptversammlungssaison neben vielen technischen Problemen auch von einer hohen Termindichte geprägt. Dies erschwerte Aktionären die Teilnahme an Online-Hauptversammlungen nicht nur, sondern machte sie institutionellen Investoren teilweise unmöglich. So haben zum Beispiel am 17. Mai 2023 insgesamt 21 im HDAX vertretene Unternehmen ihre Hauptversammlung abgehalten.
„Ein echter Dialog zwischen Aktionären, Vorstand und Aufsichtsrat konnte auch bei den Online-Hauptversammlungen 2023, deren technische Durchführung häufig zu wünschen übrigließ, nicht stattfinden. Das hat die Hauptversammlung als oberstes Kontrollorgan und Sprachrohr der Aktionäre weiter entwertet“, sagt Thomas Richter, Hauptgeschäftsführer des deutschen Fondsverbands BVI.
Die überwiegende Mehrheit der 160 in der DAX-Familie vertretenen Unternehmen hat sich die Ermächtigung eingeholt, auch künftig virtuelle Hauptversammlungen abhalten zu können. Dabei haben sich immerhin 97 Unternehmen an den BVI-Analyseleitlinien für Hauptversammlungen (ALHV) orientiert und diese Option zunächst nur für zwei Jahre vorgesehen. 41 Unternehmen haben die Satzungsänderung auf fünf Jahre befristet.
Zukunftsfinanzierungsgesetz schränkt Aktionärsrechte weiter ein
Nach Einführung der virtuellen Hauptversammlung droht nun mit dem Zukunftsfinanzierungsgesetz ein weiterer Eingriff in die Aktionärsrechte. Die im aktuellen Regierungsentwurf vorgesehene Einführung von Mehrstimmrechtsaktien schadet Klein- wie Großanlegern zusätzlich, da solche Aktien Kontroll- und Mitspracherechte der Eigentümer entsprechend ihrer Kapitalbeteiligung verhindern.
Das „one share, one vote“-Prinzip ist jedoch essenziell für effektives – und von der Politik gefordertes – Engagement institutioneller Investoren, um die Corporate Governance von Unternehmen zu stärken oder auch die nachhaltige Transformation der Wirtschaft voranzutreiben. Die Ampelkoalition schießt dabei auch über das eigentliche Ziel der Förderung von Start-ups und Wachstumsunternehmen hinaus, weil sie Mehrstimmrechtsaktien für Börsengänge aller Unternehmen zulassen will.
ETFs werden so gezwungen, noch stärker in Unternehmen zu investieren, die Aktionärsrechte beschneiden. Wirkliche Anreize zur Stärkung der Aktienanlage lässt der Regierungsentwurf hingegen gänzlich vermissen.
Weiteres Verbesserungspotenzial bei der Unternehmensführung
In der Hauptversammlungssaison 2023 waren bei der Qualität der Beschlussvorlagen der Gesellschaften wieder gravierende Beanstandungen zu verzeichnen. Die meiste Kritik gab es gegenüber den Aufsichtsräten. So war bei 107 (2022: 100), also bei mehr als 65 Prozent der HDAX-Unternehmen, die Entlastung des Aufsichtsrats als kritisch anzusehen, insbesondere weil die Gremien nicht mit einer ausreichenden Zahl unabhängiger Vertreter besetzt waren.
Bei 60 (2022: 55) Unternehmen gab es Beanstandungen zu den Wahlen zum Aufsichtsrat, vor allem weil die Vorgaben der ALHV zur Beschränkung von Aufsichtsratsmandaten nicht eingehalten wurden. Viel Anlass zur Kritik boten auch die Vergütungsberichte für Vorstand und Aufsichtsrat. Die Unternehmen müssen diese Berichte jährlich erstellen und von der Hauptversammlung billigen lassen. Bei 87 von 160 Gesellschaften, also bei mehr als der Hälfte der HDAX-Unternehmen, entsprachen die zur Billigung vorgelegten Vergütungsberichte nicht den Vorstellungen der Fondswirtschaft zu guter Unternehmensführung.
Positiv hervorzuheben ist, dass eine weiter wachsende Zahl von Unternehmen, wie in den ALHV gefordert, ESG-Komponenten bei der Vergütung der Vorstände einfließen lässt. So berücksichtigen mittlerweile alle DAX-40-Unternehmen mindestens eine der drei ESG-Komponenten bei der Bezahlung ihrer Vorstände. Nur insgesamt 19 Unternehmen in MDAX und SDAX machen die Vorstandsvergütung noch nicht von ESG-Zielen abhängig.
Dies sind Auszüge aus den Ergebnissen einer Untersuchung der Hauptversammlungssaison 2023 auf Basis der BVI-ALHV, die der Fondsverband mit Unterstützung des Aktionärsdienstleisters IVOX Glass Lewis bei 160 Unternehmen der DAX-Familie (DAX 40, MDAX und SDAX) erstellt hat.
Über die Analyse-Leitlinien des BVI
Die Analyse-Leitlinien des BVI für Hauptversammlungen (ALHV) stellen Eckpunkte für eine gute Unternehmensführung aus Sicht des BVI dar. Sie machen Fondsgesellschaften keine verbindliche Vorgabe für das jeweilige Abstimmungsverhalten auf der Hauptversammlung, sind in der Branche inzwischen aber zum Mindeststandard geworden.
Die Mitglieder des BVI halten in ihren Fonds Aktien deutscher Unternehmen im Wert von 168 Milliarden Euro. Dabei agieren die Fondsgesellschaften als Treuhänder ihrer Anleger gegenüber diesen Unternehmen und üben die Aktionärsrechte in deren Interesse aus. Sie orientieren sich dabei an anerkannten Branchenstandards wie den Wohlverhaltensregeln des BVI.
Der BVI untersucht jährlich mit Unterstützung des Aktionärsdienstleisters IVOX Glass Lewis die abgelaufene Hauptversammlungssaison auf Einhaltung der ALHV. Konkret werden die 160 Unternehmen der DAX-Familie (DAX, MDAX und SDAX) überprüft.
Themen:
LESEN SIE AUCH
Hauptversammlungen: BVI lehnt Verlängerung der Notfallregelungen ab
Nachhaltigkeitskonferenz des BVI: ESG im Spannungsfeld zwischen Praxis, Politik und Performance
Über 150 Teilnehmende aus Fondsindustrie, Finanzaufsicht, Wissenschaft und Realwirtschaft diskutierten am 3. Juli 2025 in Frankfurt am Main auf Einladung des Bundesverbands Investment (BVI) über aktuelle Herausforderungen nachhaltiger Kapitalanlagen. Im Mittelpunkt standen Fragen der Regulierung, Transparenz – und der Umgang mit Gegenwind für ESG-Investments.
Zwischen Zauber und Zahlen: Warum deutsche Aktien wieder Chancen bieten
Trotz Konjunktursorgen, geopolitischer Spannungen und struktureller Probleme sehen viele Anleger wieder Potenzial im deutschen Aktienmarkt. Portfoliomanager Olgerd Eichler von MainFirst nennt sechs gute Gründe – mit überraschend positiven Langfristaussichten.
Passives Einkommen – mit Dividenden und ETFs langfristig profitieren
Viele Menschen wollen ein passives Einkommen aufbauen, um finanziell unabhängiger zu werden und langfristig von Kapitalerträgen zu profitieren. Zwei interessante Möglichkeiten, dies zu erreichen, sind Investitionen in Dividendenaktien und börsengehandelte Fonds (ETFs). Informatives die Grundlagen des Investierens in diese Anlageklassen.
Unsere Themen im Überblick
Themenwelt
Wirtschaft
Management
Recht
Finanzen
Assekuranz
Höhere Pfändungsfreigrenzen ab 1. Juli 2025: Was das für Gläubiger bedeutet
Zum 1. Juli 2025 steigen die Pfändungsfreigrenzen – für Schuldner:innen bedeutet das mehr finanzieller Spielraum, für Gläubiger hingegen weniger pfändbare Beträge und längere Rückzahlungszeiträume. Was das konkret heißt und worauf Gläubiger jetzt achten müssen.
In der Steuerung des Kreditrisikos liegt ein strategischer Hebel
Protektionismus, Handelskonflikte, geopolitische Risiken – die Unsicherheit an den Märkten bleibt hoch. Passive Kreditstrategien stoßen in diesem Umfeld schnell an ihre Grenzen. Warum gerade aktives Management und ein gezielter Umgang mit Kreditaufschlägen den Unterschied machen können, erklärt Jörg Held, Head of Portfolio Management bei Ethenea.
Mehrheit befürwortet Rüstungsinvestments – Akzeptanz steigt auch bei nachhaltigen Fonds
Private Geldanlagen in Rüstungsunternehmen polarisieren – doch laut aktueller Verivox-Umfrage kippt die Stimmung: 56 Prozent der Deutschen halten solche Investments inzwischen für legitim. Auch nachhaltige Fonds greifen vermehrt zu.
PKV-Initiative „Heal Capital 2“: Neuer Fonds, neue Investoren, neue Start-ups
Digitale Wartung, KI-Zertifizierung, stärkere europäische Vernetzung: Der PKV-Investitionsfonds Heal Capital geht mit neuer Schlagkraft an den Start – und will die digitale Versorgung nachhaltig verändern. Doch welche Start-ups profitieren zuerst?
Die neue Ausgabe kostenlos im Kiosk
Werfen Sie einen Blick in die aktuelle Ausgabe und überzeugen Sie sich selbst vom ExpertenReport. Spannende Titelstories, fundierte Analysen und hochwertige Gestaltung – unser Magazin gibt es auch digital im Kiosk.