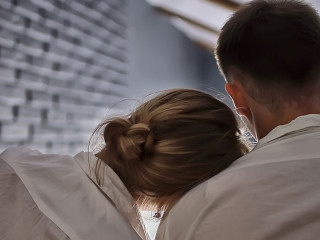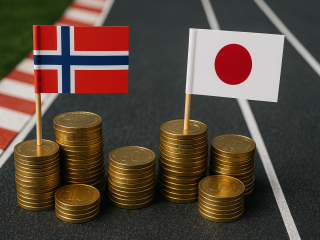Um die Folgen der Corona-Krise abzufedern, versprach die Bundesregierung umfassende, milliardenschwere Hilfszahlungen, die schnell und vor allem unbürokratisch bei Unternehmen in existenzbedrohender Schieflage ankommen sollten.
So weit die Theorie. In der Praxis ergibt sich jedoch ein sehr differenziertes Bild. Zwar berichten einige Ladenbesitzer, Mittelständler und Gastronomen, dass sie noch nie so viel Geld zur Verfügung hatten wie aktuell.
Bei anderen liegen die Nerven nach Monaten des Lockdowns jedoch blank. Rücklagen, Reserven und Eigenkapital sind erschöpft und staatliche Hilfen kommen nur sehr zögerlich oder mit Abschlägen an. Software-Fehler, komplizierte Antragsverfahren und hohe bürokratische Hürden erklären dies nur zum Teil. Auch in der Kommunikation sind entscheidende Fehler gemacht worden.
Rechtsunsicherheiten aufgrund von Fehlkommunikation und bürokratischer Hürden
Die Folge sind erhebliche Rechtsunsicherheiten, die Missbrauch fördern und Investitionsentscheidungen erschweren. So wurde beispielsweise bei den November- und Dezemberhilfen versprochen, dass bis zu 75 Prozent des Umsatzes aus dem Vorjahr erstattet werden. Als Bemessungsgrundlage sagen Verkaufserlöse jedoch nichts über den tatsächlichen Hilfsbedarf eines Unternehmens aus.
Zwar wurde versucht, mit Bezug auf EU-rechtliche Beihilferegelungen zurückzurudern, sodass finanzielle Zuschüsse nur entstandene Verluste kompensieren, allerdings revidierte die Regierung dieses Vorhaben, sodass es bei einer Erstattung von bis zu 75 Prozent des Vorjahresumsatzes bleibt.
Mögliche Rückforderungen hemmen Investitionen
Zudem können Unternehmen, laut Wirtschaftsministerium, bei den November- und Dezemberhilfen auch entgangene Gewinne geltend machen. Eine Korrektur dessen findet erst bei den Hilfen 2021 statt. Aus rechtlicher Sicht ist dieses Hin und Her weder nachvollziehbar noch förderlich für das wirtschaftliche Klima, die Konjunktur und die zu erhaltenden Arbeitsplätze.
Im Gegenteil: Einige Unternehmer sind durch die bisher ausgezahlten Gelder zwar liquide, scheuen sich jedoch davor, diese aus Angst vor möglichen Rückforderungen für Investitionen zu verwenden. Hier gilt es anzusetzen und stabile rechtliche Rahmenbedingungen zu schaffen.
Dabei muss klar sein, dass staatliche Beihilfen keinesfalls zur Besserstellung einzelner Betriebe führen dürfen. Schließlich sollen die Hilfsgelder pandemiebedingte Nachteile, beispielsweise durch eine offiziell angeordnete Geschäftsschließung, kompensieren, nicht aber Betriebe sanieren, die bereits vor der Corona-Krise marode waren. Ein Beitrag im Original der Korten AG über news aktuell.
Themen:
LESEN SIE AUCH
Sondervermögen: Milliardenschwere Mogelpackung?
Sondervermögen als Schattenhaushalt: Wie die Bundesregierung Haushaltslöcher stopft
J O Hambro: SAP, Siemens und Rheinmetall als Gewinner globaler Wachstumstrends
BFH-Urteil zum freiwilligen Wehrdienst: Wann Kindergeld trotz Soldatendienst gezahlt wird
Unsere Themen im Überblick
Themenwelt
Wirtschaft
Management
Recht
Finanzen
Assekuranz
Globale Asset Owner im Umbruch: Norwegens Staatsfonds überholt Japans
Anleihen kontra Aktien? Warum die Risikoprämie kippt
„Wir sind weit entfernt von einer KI-Blase“
Finanzielle Freiheit: Generation Z zwischen Ideal und Realität
Die neue Ausgabe kostenlos im Kiosk
Werfen Sie einen Blick in die aktuelle Ausgabe und überzeugen Sie sich selbst vom ExpertenReport. Spannende Titelstories, fundierte Analysen und hochwertige Gestaltung – unser Magazin gibt es auch digital im Kiosk.