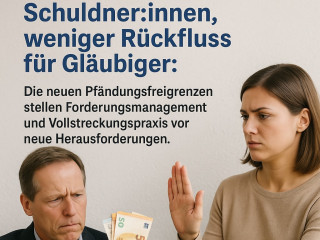Wo beginnt Armut, wo Reichtum? Weil die gängigen Definitionen immer wieder kritisiert werden, haben Forscherinnen die Grenzen neu vermessen. Die empirischen Ergebnisse ihrer neuen, von der Hans-Böckler-Stiftung geförderten Studie liegen nahe an den bisher geltenden Schwellen. 1
Wer weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens zur Verfügung hat, ist arm oder armutsgefährdet. Wer mindestens doppelt so viel verdient wie die Person genau in der Mitte der Verteilung, ist reich. Auf dieser in Statistik und Wissenschaft weit verbreiteten Konvention beruhen die meisten Aussagen darüber, wie der gesellschaftliche Wohlstand verteilt ist.
Aber könnte es nicht sein, dass 60 Prozent immer noch nicht für einen erträglichen Lebensstandard reichen? Und was ist mit den Vermögen: Warum sollte jemand arm sein, der oder die zwar nur ein geringes Einkommen, aber dafür ein eigenes Haus hat? Sind, andererseits, Beschäftigte mit hohem Lohn, aber ohne nennenswertes Vermögen, wirklich schon reich?
Die Sozialforscherin Dr. Irene Becker und Dr. Tanja Schmidt und Dr. Verena Tobsch vom Institut für empirische Sozial- und Wirtschaftsforschung (INES) in Berlin haben Begriffe wie "arm", "prekär", "knappe Teilhabe" und "reich" neu definiert und stellen sie auf den empirischen Prüfstand. In ihrer Studie haben sie mehr Daten einbezogen als üblich: nämlich auch Vermögen, Spar- und Ausgabeverhalten. Auf dieser Basis lassen sich - anhand von in den Daten vorgefundener Muster - Gruppen bilden.
Beispiel: Die Ausgaben für Nahrungsmittel steigen im unteren Bereich der Verteilung mit zunehmendem Einkommen stark an. Zusätzliches Einkommen wird in Haushalten mit wenig Geld überwiegend zur Befriedigung der elementaren Grundbedürfnisse aufgewendet, der Rückstand gegenüber Haushalten mit mittlerem Einkommen zuerst auf diesem Gebiet verringert. Ab einem gewissen Punkt wird die Kurve jedoch flacher. Bis zu dieser "Sättigungsgrenze" besteht nach der Interpretation der Forscherinnen ein "ungedeckter Bedarf". Vermögen und Vermögensbildung durch Sparen spielen in diesem Bereich der Verteilung keine Rolle - im Schnitt wird "entspart": Ersparnisse werden aufgelöst oder Geld wird geliehen.
Nach den Berechnungen der Forscherinnen mit Daten der repräsentativen Einkommens- und Verbrauchsstichproben (EVS) des Statistischen Bundesamts endet dieser als Armut klassifizierte Abschnitt der Verteilung bei einem Einkommen von rund 65 Prozent des mittleren Einkommens, sofern ein allenfalls geringes Vermögen vorhanden ist. Die Armutsgrenze ist also nicht sehr weit von den üblicherweise verwendeten 60 Prozent entfernt ist. Mit Einkommen ist hier das sogenannte Nettoäquivalenzeinkommen gemeint, das heißt: Abgaben an Staat und Sozialversicherung sind bereits abgezogen, Sozialtransfers berücksichtigt, und durch Gewichtungsfaktoren werden Unterschiede in der Haushaltsgröße berücksichtigt, sodass sich etwa Ein- und Vierpersonenhaushalte sinnvoll vergleichen lassen.
Oberhalb der Armut sehen Becker, Schmidt und Tobsch einen Prekaritätsbereich. Sie meinen damit eine finanzielle Ausstattung, die für die Befriedigung grundlegender physischer Bedürfnisse ausreicht, mit der eine Teilnahme am "normalen" gesellschaftlichen Leben aber aus materiellen Gründen erschwert ist. Als Indikator dienen hier die Ausgaben für Bekleidung und soziokulturelle Teilhabe.
Das können zum Beispiel die Kosten für Handy, Internet oder einen Cafébesuch sein. Ähnlich wie bei den Nahrungsmitteln am unteren Ende der Verteilung zeigt sich hier ein großer ungedeckter Bedarf, der erst "an der Schwelle zum Übergang in den breiten Teilhabebereich" eine "vorläufige Sättigung" findet. Diese Schwelle verläuft bei etwa 80 Prozent des mittleren Einkommens.
Finanzielle Sicherheit und entsprechende gesellschaftliche Teilhabe können sich statt aus laufendem Einkommen auch aus Rücklagen speisen. So wird bei der Berechnung der Zahl der Haushalte in prekärer Lage eine sehr kleine Gruppe ausgeklammert, die über Vermögen von mehr als dem Dreifachen des mittleren Jahreseinkommens verfügt. In ihrem Fall griffe der bloße Blick aufs Einkommen also zu kurz. Mit gerade einmal zwei Prozent aller Haushalte im Prekaritätsbereich fällt diese Konstellation allerdings gesamtgesellschaftlich kaum ins Gewicht.
Die Mittelschicht lässt sich anhand von Einkommen, Vermögen, Ersparnisbildung und Ausgabeverhalten in drei Gruppen aufteilen. Die Wissenschaftlerinnen sprechen von knapper, guter und sehr guter Teilhabe. Dafür gelten die folgenden Einkommensgrenzen, wobei wie bei allen Berechnungen das mittlere (Median) Nettoäquivalenzeinkommen den Bezugspunkt bildet:
- Knappe Teilhabe: 80 bis 105 Prozent (falls erhebliche Ersparnisse/Vermögenswerte - konkret: von mehr als dem Dreifachen des mittleren Jahreseinkommens - vorliegen: 70 bis 95 Prozent),
- Gute Teilhabe: 105 bis 150 Prozent (95 bis 150 Prozent im Falle erheblicher Vermögen),
- Sehr gute Teilhabe: 150 bis 200 Prozent (150 bis 175 Prozent im Falle erheblicher Vermögen).
Politisch wie wissenschaftlich relevanter - und umstrittener - ist jedoch die Frage, wo der letzte Abschnitt der Verteilung beginnt: der Reichtum. In den Worten der Forscherinnen: eine "reiche Ressourcenausstattung", die durch Einkommen und Vermögen "einen weit überdurchschnittlichen Lebensstandard" bei gleichzeitig weiterem Vermögensaufbau ermöglicht.
Ausgaben für bestimmte Produktgruppen oder Aktivitäten taugen wenig zur Bestimmung von Reichtum. Denn "hohe Einkommen und Vermögen bieten die Möglichkeit, Individualisierung und Differenzierung je nach Präferenzen ohne Einschränkungen auszuleben, was sich in der Ausgabenstruktur widerspiegelt". Lediglich die Höhe der Konsumausgaben insgesamt kommt als Indikator infrage.
Bei Menschen, die das Doppelte bis Zweieinhalbfache des mittleren Einkommens verdienen, lagen sie 2018 im Schnitt um 76 Prozent über dem in der gesellschaftlichen Mitte Üblichen. Bei noch höheren Einkommen betrug der Wert 101 Prozent, wobei Personen mit höherem Vermögen mehr konsumieren. Auch die laufende Ersparnis ist im obersten Einkommenssegment beträchtlich. So legen beispielsweise Alleinstehende mit dem Doppelten bis Zweieinhalbfachen des mittleren Einkommens im Schnitt gut 1300 Euro im Monat zurück.
Konsumausgaben und Ersparnis steigen nach den Auswertungen der Forscherinnen im Einkommensbereich um das Doppelte des Mittelwerts sehr dynamisch an. Insofern liegt eine Grenzziehung zwischen "sehr guter Teilhabe" und "Reichtum" in diesem Abschnitt nahe - was wiederum für die gewöhnlich benutzte 200-Prozent-Schwelle als Reichtumsgrenze spricht. Letztlich erscheint Becker, Schmidt und Tobsch der Wert von 175 Prozent als angemessen, sofern der entsprechende Haushalt zusätzlich wenigstens drei mittlere Jahreseinkommen auf der hohen Kante hat. Denn bereits Haushalte, die beim Einkommen unter der 200-Prozent-Marke liegen, ähneln in vieler Hinsicht den reicheren, sofern sie über größeres Vermögen verfügen.
Die Wissenschaftlerinnen ziehen das Fazit: Angesichts ihrer "theoretisch-empirisch fundiert" abgeleiteten Ergebnisse könnten die Aussagen der Armuts- und Reichtumsforschung sowie der "etablierten Sozialbericherstattung" nicht mehr als "statistische Konstrukte auf der Basis willkürlicher Setzungen gedeutet und damit abgetan werden". Eher seien die bisher üblichen Grenzziehungen für Deutschland zu vorsichtig: "zu niedrig hinsichtlich der Armut und zu hoch bei der Erfassung von Reichtum".
Quellen:
1 Irene Becker, Tanja Schmidt, Verena Tobsch: Wohlstand, Armut und Reichtum neu ermittelt, Study der HBS-Forschungsförderung Nr. 472, Juli 2022
Themen:
LESEN SIE AUCH
Generation X geht bei Geldanlagen unnötige Risiken ein
Was die Psyche mit Geldanlegern macht: 47 Prozent der Anleger aus der Generation X gehen bei der Geldanlage mehr Risiken ein, als es ratsam wäre. Dabei spielen unterschiedliche Faktoren eine Rolle: Ungeduld oder der Traum vom schnellen Reichtum, aber auch die Angst, im Zuge der wirtschaftlichen Situation im Alter nicht mehr über die Runden zu kommen.
Privathaushalte erholen sich vom Energiepreisschock und wollen konsumieren
Die Energiepreise sind gesunken, die Inflationsrate zurückgegangen. Weniger Menschen fühlen sich durch hohe Energiepreise belastet. Und weniger wollen ihren Konsum einschränken. Das dürfte den privaten Verbrauch ankurbeln und die Konjunktur stützen.
70,7 Mrd. Euro Zinsen verloren: Sparer verschenken ein Vermögen
Zwar steigen die Zinsen für Tagesgeld und Festgeld, doch scheinen viele Sparer Zinsangebote kaum zu vergleichen oder sich schlicht mit zu wenig zufriedenzugeben. Mit immer noch hohen Beträgen auf Girokonten, Sparbüchern und Sparkonten entsteht ihnen in diesem Jahr ein immenser Zinsausfall.
Jede zweite Frau verschleppt die finanzielle Altersvorsorge
Fatal: Knapp die Hälfte der Bundesbürgerinnen weiß, dass sie sich mehr mit ihrer finanziellen Ruhestandsplanung beschäftigen sollte, schiebt das Thema allerdings vor sich her. Bei jungen Frauen liegt die Zustimmung mit 56 Prozent sogar noch höher – oft aufgrund fehlenden Finanzwissens.
Unsere Themen im Überblick
Themenwelt
Wirtschaft
Management
Recht
Finanzen
Assekuranz
Zwischen Zauber und Zahlen: Warum deutsche Aktien wieder Chancen bieten
Trotz Konjunktursorgen, geopolitischer Spannungen und struktureller Probleme sehen viele Anleger wieder Potenzial im deutschen Aktienmarkt. Portfoliomanager Olgerd Eichler von MainFirst nennt sechs gute Gründe – mit überraschend positiven Langfristaussichten.
Höhere Pfändungsfreigrenzen ab 1. Juli 2025: Was das für Gläubiger bedeutet
Zum 1. Juli 2025 steigen die Pfändungsfreigrenzen – für Schuldner:innen bedeutet das mehr finanzieller Spielraum, für Gläubiger hingegen weniger pfändbare Beträge und längere Rückzahlungszeiträume. Was das konkret heißt und worauf Gläubiger jetzt achten müssen.
In der Steuerung des Kreditrisikos liegt ein strategischer Hebel
Protektionismus, Handelskonflikte, geopolitische Risiken – die Unsicherheit an den Märkten bleibt hoch. Passive Kreditstrategien stoßen in diesem Umfeld schnell an ihre Grenzen. Warum gerade aktives Management und ein gezielter Umgang mit Kreditaufschlägen den Unterschied machen können, erklärt Jörg Held, Head of Portfolio Management bei Ethenea.
Mehrheit befürwortet Rüstungsinvestments – Akzeptanz steigt auch bei nachhaltigen Fonds
Private Geldanlagen in Rüstungsunternehmen polarisieren – doch laut aktueller Verivox-Umfrage kippt die Stimmung: 56 Prozent der Deutschen halten solche Investments inzwischen für legitim. Auch nachhaltige Fonds greifen vermehrt zu.
Die neue Ausgabe kostenlos im Kiosk
Werfen Sie einen Blick in die aktuelle Ausgabe und überzeugen Sie sich selbst vom ExpertenReport. Spannende Titelstories, fundierte Analysen und hochwertige Gestaltung – unser Magazin gibt es auch digital im Kiosk.