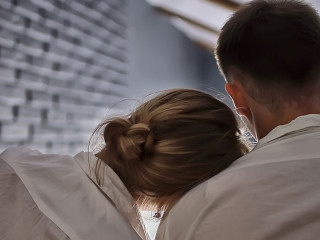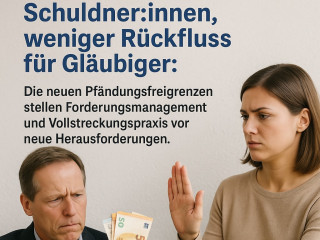Der Anteil der Erwerbspersonen an der Bevölkerung geht in den nächsten Jahrzehnten drastisch zurück. Das hat gravierende Folgen für Wirtschaft und materiellen Wohlstand in Deutschland. Doch Bildung und Gesundheit sind wirkungsvolle Hebel, diese Entwicklung abzumildern. Sie können deutlich mehr Menschen in Arbeit bringen – und das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen um bis zu 3.900 Euro steigern.
Durch den demografischen Wandel droht die Erwerbsbevölkerung in Deutschland bis zum Jahr 2050 um 5,1 Millionen zu schrumpfen. Investitionen in Bildung und eine bessere Integration von Menschen mit gesundheitlichen Beschwerden in den Arbeitsmarkt können aber die Beschäftigung erhöhen und den drohenden Arbeitskräftemangel teilweise kompensieren.
Mit Bildungsexpansion gegen den demografischen Wandel
Setzt sich die bisherige, durch das Bildungsniveau der Eltern bestimmte Bildungsexpansion fort, kann den Simulationsrechnungen zufolge im Jahr 2050 die Schrumpfung der Erwerbsbevölkerung um etwa 745.000 Arbeitskräfte, also etwa 15 Prozent, abgefedert werden.
Gelänge durch weitere Investitionen noch eine breitere Bildungsexpansion, könnte das Deutschland 2050 zusätzlich 60.000 und in der Summe etwa 800.000 mehr Erwerbspersonen bringen. Voraussetzung für diese Bildungsexpansion ist, dass es zusätzlich jeweils 25 Prozent einer Bildungsstufe schaffen, in die nächsthöhere Stufe aufzusteigen.
Der nur geringe Zuwachs an Erwerbspersonen bis 2050 erklärt sich dadurch, dass bei einer Bildungsexpansion junge Menschen länger in Ausbildung sind und in dieser Zeit dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen. Erst wenn sich die heute Jungen der Rente nähern, entfaltet die Bildungsexpansion ihre volle Wirkung.
Die demografisch bedingte Schrumpfung bis zum Jahr 2080 (5,9 Millionen gegenüber 5,1 Millionen in 2050) würde so in der Summe dann um etwa 1,3 Millionen geringer ausfallen.
Jörg Dräger, Vorstandsmitglied der Bertelsmann Stiftung, erklärt dazu:
„Der demografische Wandel erfordert mehr Investitionen in Bildung. Menschen mit einem höheren Bildungsniveau sind seltener arbeitslos. Sie haben bessere Chancen auf attraktive Beschäftigung, bekommen ein höheres Gehalt und arbeiten auch mehr Stunden. Bildungsinvestitionen lohnen sich auch ökonomisch.“
Störfaktor Corona-Krise
Die Corona-Krise könnte allerdings zur Bedrohung für eine Bildungsexpansion und damit für den zukünftigen Wohlstand werden. Bleiben Kitas und Schulen länger geschlossen, wird eine Schüler*innen-Generation abgehängt. Damit gerät der Bildungsaufstieg in Gefahr. Weil sie zumeist mit einer schlechteren technischen Ausstattung zurechtkommen müssen und im Homeschooling weniger Unterstützung durch ihre Eltern bekommen, sind insbesondere Kinder der niedrigeren Bildungsschichten betroffen.
Dräger sagt:
„Wenn wir bildungsferneren Kindern den Bildungsaufstieg ermöglichen, hat das den größten positiven Effekt auf die Erwerbsbeteiligung.”
Wenn in Zukunft zusätzlich zu einer breiten Bildungsexpansion auch Personen mit gesundheitlichen Beschwerden stärker am Arbeitsleben teilhaben könnten, ließen sich die negativen Effekte des demografischen Wandels weiter lindern.
Gelänge uns das genauso gut wie dem Spitzenreiter Schweden, könnten im Jahr 2050 durch diese Kombination von Bildungsexpansion und Arbeitsmarktintegration in der Summe etwa 1,9 Millionen Menschen dem Arbeitsmarkt zusätzlich zur Verfügung stehen, im Jahr 2080 wären es etwa 2,3 Millionen. Der Schrumpfungsprozess ließe sich so insgesamt zu mehr als einem Drittel kompensieren.
Bildung und Gesundheit erhöhen das Pro-Kopf-Einkommen
Eine breite Bildungsexpansion wirkt sich langfristig auch positiv auf das Bruttoinlandsprodukt (BIP) und das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen aus, da mehr Menschen zum materiellen Wohlstand beitragen. Das reale BIP pro Kopf könnte dadurch im Jahr 2050 um fast 300 Euro höher sein (in Preisen des Jahres 2015) als wenn diese Bildungsexpansion ausbliebe.
Im Jahr 2080 wäre das BIP pro Kopf 1.700 Euro höher als ohne Bildungsexpansion. Noch größer wäre der Effekt, wenn zusätzlich mehr Menschen trotz gesundheitlicher Probleme in den Arbeitsmarkt integriert würden. Das reale jährliche Pro-Kopf-Einkommen stiege dann bereits im Jahr 2050 um etwa 1.500 Euro und im Jahr 2080 sogar um fast 3.900 Euro.
Das ist das Ergebnis einer Studie des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (WIFO) im Auftrag der Bertelsmann Stiftung.
Themen:
LESEN SIE AUCH
Inflationssorgen auf neuem Rekordhoch
Pandemie als finanzielles Risiko der Mittelschicht
Servicebeste Unternehmen: Interhyp und Münchener Verein ausgezeichnet
Staat belastet Gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung mit versicherungsfremden Leistungen
Allein in der Pflegeversicherung entfallen pro Jahr 3,5 Mrd. Euro auf Rentenversicherungsbeiträge für pflegende Angehörige, die derzeit aus Beitragsmitteln finanziert werden. In der GKV werden gesamtgesellschaftliche Lasten von rund 20 Mrd. Euro im Jahr über Versicherungsbeiträge getragen. Auch die fehlende Kompensation der Zahlungen für Bürgergeldempfänger in Höhe von rund 9 Mrd. Euro wirkt sich belastend aus.
Unsere Themen im Überblick
Themenwelt
Wirtschaft
Management
Recht
Finanzen
Assekuranz
Kryptowährungen als riskantes Investment – gehören sie in ein modernes Portfolio?
J O Hambro: SAP, Siemens und Rheinmetall als Gewinner globaler Wachstumstrends
Trotz schwacher Konjunktur sieht J O Hambro neue Chancen für deutsche Unternehmen. Warum fiskalische Impulse und strukturelle Reformen den DAX beflügeln könnten – und welche Branchen unter Druck geraten.
Zwischen Zauber und Zahlen: Warum deutsche Aktien wieder Chancen bieten
Trotz Konjunktursorgen, geopolitischer Spannungen und struktureller Probleme sehen viele Anleger wieder Potenzial im deutschen Aktienmarkt. Portfoliomanager Olgerd Eichler von MainFirst nennt sechs gute Gründe – mit überraschend positiven Langfristaussichten.
Höhere Pfändungsfreigrenzen ab 1. Juli 2025: Was das für Gläubiger bedeutet
Zum 1. Juli 2025 steigen die Pfändungsfreigrenzen – für Schuldner:innen bedeutet das mehr finanzieller Spielraum, für Gläubiger hingegen weniger pfändbare Beträge und längere Rückzahlungszeiträume. Was das konkret heißt und worauf Gläubiger jetzt achten müssen.
Die neue Ausgabe kostenlos im Kiosk
Werfen Sie einen Blick in die aktuelle Ausgabe und überzeugen Sie sich selbst vom ExpertenReport. Spannende Titelstories, fundierte Analysen und hochwertige Gestaltung – unser Magazin gibt es auch digital im Kiosk.