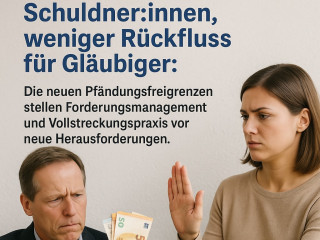In Brasilien ist direkt nach der Einführung wieder Schluss und in Indien gibt es auch nach zweijähriger Testphase noch keinen vollständigen Launch. Will es einfach nicht rund laufen beim Debut des Zahlungsdienstes in den beiden größten Märkten von WhatsApp? Woran hapert es? Wie sind die Aussichten für europäische Nutzer? Panagiotis Karasavvoglou, Country Manager Merchant Services von Worldline in Deutschland, macht den Reality Check.
Check 1: Brauchen wir diesen Service überhaupt?
Diese Situationen kennt sicher jeder: Man möchte Freunden geliehenes Geld zurückgeben oder man legt für ein Geschenk für den Kollegen zusammen – in der Regel handelt es sich dabei um kleinere Beträge. Sich dafür extra ins Online Banking einzuloggen, ist umständlich und Bargeld hat heute auch nicht mehr jeder immer dabei.
Das war vor einigen Jahren der Ausgangspunkt für TWINT, eine Schweizer Mobile-Payment-Lösung an der auch Worldline beteiligt ist und die mittlerweile auch im gesamten Schweizer Handel akzeptiert und gerne verwendet wird. Aus User-Sicht wäre es natürlich auch eine praktische Lösung, Kleinbeträge im privaten Alltag (P2P) direkt im ohnehin genutzten Messenger zu schicken.
Was für Europa interessant klingt, gilt umso mehr für Länder wie Indien oder auch Brasilien. Dort finden wir keine vollflächige Infrastruktur wie in Europa oder den USA vor, weder was die Versorgung mit Bankdienstleistungen noch die Ausstattung mit Technologie angeht.
Das vergleichsweise günstige und kompakte Smartphone bildet hier eine Ausnahme: Es hat sich auch und gerade in den Schwellenländern in den letzten Jahren rasend schnell verbreitet. In seinem größten Markt Indien kommt allein WhatsApp auf über 400 Millionen Nutzer, in Brasilien immerhin auf über 100 Millionen. Kartenzahlungen sind dagegen bei weitem nicht so verbreitet wie in Nordamerika oder Europa. Zusammengenommen bieten diese Faktoren ideale Bedingungen für Mobile Payment.
China hat es vorgemacht: Die Ära der Karten wurde dort quasi übersprungen und im Reich der Mitte ging man direkt von Bargeld zu Mobile Payment über – der Erfolg von Alipay spricht für sich. An einem fehlenden Bedarf können die Rückschläge für WhatsApps Bezahldienst also nicht liegen.
Check 2: Legen die Regierungen WhatsApp Steine in den Weg?
Tatsächlich prüft die indische Wettbewerbskommission eine Beschwerde gegen WhatsApp. Hintergrund ist die Befürchtung, dass Facebooks Dienst aufgrund seiner dominanten Stellung im Messenger-Bereich auf dem Payment-Markt unfaire Wettbewerbsvorteile erringen könnte. Daneben gibt es weitere Konfliktpunkte mit örtlichen Regularien, was sogar zu einem Verfahren vor dem indischen Supreme Court geführt hat.
In Brasilien entzündete sich der Konflikt an der Frage, ob WhatsApp für seinen Dienst eine besondere Genehmigung benötige. Das Facebook-Unternehmen war der Meinung, dies sei nicht nötig, da man lediglich als Vermittler für Zahlungen fungiere. Die brasilianische Zentralbank war in dieser Frage allerdings anderer Meinung und sorgte mit ihrem Veto für einen vorläufigen Stopp des gerade erst gestarteten WhatsApp Pay.
Aktuell (Juli 2020) ist weder für Indien noch für Brasilien wirklich abzusehen, wie es weitergeht. Man kann allerdings davon ausgehen, dass Facebook seinen Schritt ins Payment so schnell nicht rückgängig machen wird. Es ist zu vermuten, dass WhatsApp daher auf die Behörden zugehen wird, um nach einer Lösung zu suchen, wie der Dienst doch noch gelauncht werden kann. Ein solcher Prozess könnte sich allerdings noch längere Zeit hinziehen.
Check 3: Kommt der Payment-Dienst nun gar nicht mehr nach Europa?
Mark Zuckerberg hatte Anfang des Jahres noch einen geplanten globalen Launch innerhalb der kommenden Monate angekündigt. Davon ist man jetzt allerdings wohl abgerückt. Inwieweit hier die Corona-Pandemie und/oder die Rückschläge in Indien und Brasilien eine Rolle spielen, ist für Außenstehende schwer zu beurteilen. Bis wir hierzulande statt Smileys Geld verschicken können, wird es auf jeden Fall noch einige Zeit dauern.
Check 4: Wie europareif ist Mobile Payment überhaupt?
Fehlen bei uns etwa die Voraussetzungen für Services wie WhatsApp Pay? Nein, denn auf den hiesigen Märkten tut sich durchaus schon einiges: Neben den großen Playern Apple Pay und Co, mit allen Ihren Vor- und Nachteilen, gibt es eine Reihe nationaler Services, die nach Skaleneffekten und Usability streben.
Mehrere Anbieter, darunter die gemeinschaftliche Schweizer Initiative TWINT, haben sich zu einer Interessensgemeinschaft namens European Mobile Payment Systems Association (EMPSA) zusammengeschlossen.
EMPSA verfolgt das Ziel, zwischen den Mitgliedern beziehungsweise den angeschlossenen mobilen Zahlungsmitteln Interoperabilität herzustellen, damit die Nutzer ihr gewohntes Zahlungsmittel auch im Ausland einsetzen können. Damit wird ein wesentlicher Meilenstein für den Siegeszug eines europäischen Mobile Payment Ökosystems geschaffen. Das macht es auch neuen Anbietern einfacher, innovative Services auf den stark regulierten europäischen Märkten anzubieten.
Fazit: Ein steiniger Weg, aber der richtige
Auf keinen Fall sollte man den Fehler begehen, in den Rückschlägen für WhatsApp den Niedergang des Mobile Payment zu sehen. Zum einen wirkte die Corona-Pandemie wie ein Booster auf das ohnehin wachsende Feld des kontaktlosen Bezahlens. Laut Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken sind bargeldlose Transkationen in Deutschland im Mai um 48 Prozent gegenüber 2019 angestiegen, die Beträge um 34 Prozent.
Außerdem gilt in der digitalen Wirtschaft: Was für den Kunden einfach ist, setzt sich durch. Seamless oder frictionless sind die Zauberwörter. PayPal und Amazons One-Click-Payment liefern die besten Beispiele. Händler müssen sich auf diese neue Marktsituation einstellen und ebenfalls mobile Bezahlmöglichkeiten anbieten, um nicht abgehängt zu werden. Dabei geht es um eine universelle, auch für Verkaufspersonal leicht bedienbare Bezahlinfrastruktur. Payment Service Provider können ihnen dabei helfen, sich auf die neuen, vielfältigen Bezahlmethoden einzustellen, sodass sich Händler ganz auf ihre Kunden konzentrieren können.
Themen:
LESEN SIE AUCH
Kontaktloses Bezahlen im Aufwind
Diese Länder haben die höchsten Reserven
DAX: In 20 Ländern gab es mehr Rendite
Allianz Trade: Mini-Wachstum 2025 – doch Deutschlands Resilienz lässt auf mehr hoffen
Trotz schleppender Weltkonjunktur sieht Allianz Trade Deutschland auf dem Weg zur wirtschaftlichen Erholung – sofern Digitalisierung, Klimainvestitionen und Strukturreformen entschlossen vorangetrieben werden.
Unsere Themen im Überblick
Themenwelt
Wirtschaft
Management
Recht
Finanzen
Assekuranz
Zwischen Zauber und Zahlen: Warum deutsche Aktien wieder Chancen bieten
Trotz Konjunktursorgen, geopolitischer Spannungen und struktureller Probleme sehen viele Anleger wieder Potenzial im deutschen Aktienmarkt. Portfoliomanager Olgerd Eichler von MainFirst nennt sechs gute Gründe – mit überraschend positiven Langfristaussichten.
Höhere Pfändungsfreigrenzen ab 1. Juli 2025: Was das für Gläubiger bedeutet
Zum 1. Juli 2025 steigen die Pfändungsfreigrenzen – für Schuldner:innen bedeutet das mehr finanzieller Spielraum, für Gläubiger hingegen weniger pfändbare Beträge und längere Rückzahlungszeiträume. Was das konkret heißt und worauf Gläubiger jetzt achten müssen.
In der Steuerung des Kreditrisikos liegt ein strategischer Hebel
Protektionismus, Handelskonflikte, geopolitische Risiken – die Unsicherheit an den Märkten bleibt hoch. Passive Kreditstrategien stoßen in diesem Umfeld schnell an ihre Grenzen. Warum gerade aktives Management und ein gezielter Umgang mit Kreditaufschlägen den Unterschied machen können, erklärt Jörg Held, Head of Portfolio Management bei Ethenea.
Mehrheit befürwortet Rüstungsinvestments – Akzeptanz steigt auch bei nachhaltigen Fonds
Private Geldanlagen in Rüstungsunternehmen polarisieren – doch laut aktueller Verivox-Umfrage kippt die Stimmung: 56 Prozent der Deutschen halten solche Investments inzwischen für legitim. Auch nachhaltige Fonds greifen vermehrt zu.
Die neue Ausgabe kostenlos im Kiosk
Werfen Sie einen Blick in die aktuelle Ausgabe und überzeugen Sie sich selbst vom ExpertenReport. Spannende Titelstories, fundierte Analysen und hochwertige Gestaltung – unser Magazin gibt es auch digital im Kiosk.