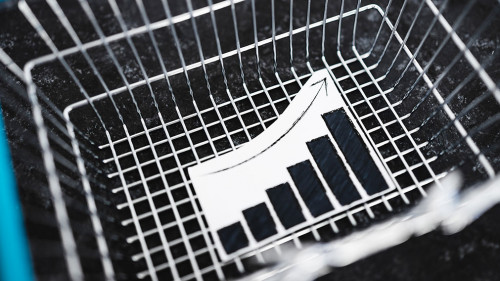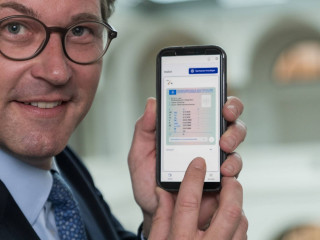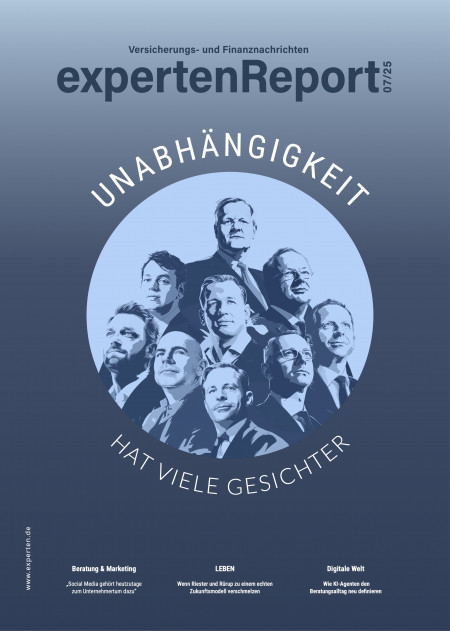Das Bundeskabinett hat den Jahreswirtschaftsbericht 2023 einschließlich der Projektion zum Wirtschaftswachstum 2023 beschlossen. Der von Vizekanzler und Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck in der Bundespressekonferenz vorgestellte Jahreswirtschaftsbericht trägt den Titel „Wohlstand erneuern“.
Der Bericht zeigt auf, wie Deutschland sich in der Krise behauptet hat. So hat das Land auch angesichts des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine und der damit verbundenen Energiekrise Stärke bewiesen. Insbesondere konsequentes staatliches Handeln hat die Krise beherrschbar gemacht.
Zudem hat sich die deutsche Wirtschaft anpassungs- und widerstandsfähig gezeigt. Auch die Verbraucherinnen und Verbraucher haben durch große Energieeinsparungen ihren Beitrag geleistet, damit Deutschland gut durch den Winter kommt.
Dank dieser Anstrengungen sind die wirtschaftlichen Aussichten für das Jahr 2023 besser als noch in der Herbstprojektion erwartet. Nach einer insgesamt positiven Entwicklung im zweiten Halbjahr 2022 geht die Bundesregierung für das laufende Jahr zwar von einer Abkühlung infolge des Energiepreisschocks und der Zinswende aus, rechnet in Summe aber mit einem Zuwachs des Bruttoinlandsproduktes von +0,2 Prozent. In der Herbstprojektion hatte sie noch mit einem Rückgang des Bruttoinlandsproduktes um -0,4 Prozent gerechnet. Diese positive Tendenz gilt es jetzt wirtschaftspolitisch zu stärken.
Gleichzeitig geht die Inflation zurück. Sie bleibt im Jahr 2023 zwar weiterhin hoch, aber die Trendwende ist eingeleitet. Nach 7,9 Prozent im Jahr 2022 sinkt die Inflation der Projektion zufolge 2023 auf 6,0 Prozent.
Auch die Unternehmen fassen wieder Vertrauen. Die Stimmung hat sich spürbar verbessert. Unternehmen investieren in moderne Anlagen und Maschinen - technisch gesprochen: Die Ausrüstungsinvestitionen steigen laut der Projektion im Jahr 2023 um 3,3 Prozent nach 2,5 Prozent im Vorjahr.
Der Jahreswirtschaftsbericht 2023 enthält neben der Projektion zentrale wirtschafts- und finanzpolitische Themenschwerpunkte der Bundesregierung. Diese sind:
1. Energieversorgung sichern, Transformation beschleunigen
Die Bundesregierung hat durch ein Bündel kurzfristig umgesetzter Maßnahmen wesentlich dazu beigetragen, eine Gasmangellage in diesem Winter zu vermeiden und die Belastungen im Zuge gestiegener Energiepreise zu begrenzen. Aufbauend hierauf gilt es, die Transformation hin zu einer treibhausgasneutralen Wirtschaft weiter zu beschleunigen.
Dabei steht der Ausbau der Erneuerbaren Energien als Grundlage für Transformation und Klimaschutz im Mittelpunkt. Mit den Maßnahmepaketen des Jahres 2022 - national wie europäisch - wurden die Weichen für einen schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien gestellt.
Der Ausbau Erneuerbarer Energien und der Netzausbau liegen EU-weit nun im überwiegenden öffentlichen Interesse, zahlreiche Hürden konnten aus dem Weg geräumt werden, so dass der Ausbau der Erneuerbaren Energie deutlich beschleunigt werden kann.
Zugleich gilt es, staatlicherseits gezielt in den Aufbau einer grünen Wirtschaft zu investieren. Dazu gehört der Einsatz des Klima- und Transformationsfonds. Flankierend sollen Klimaschutzverträge klimafreundliche Investitionen für Unternehmen rentabel machen.
2. Wettbewerbsfähigkeit stärken, transformative Angebotspolitik begründen
Um eine starke grüne Wirtschaft aufzubauen, ist es entscheidend, Deutschland als attraktiven Investitionsstandort zu stärken und die Wettbewerbsfähigkeit von Industrie und Mittelstand zu befördern. Dazu setzt die Bundesregierung in ihrem Jahreswirtschaftsbericht auf eine transformative Angebotspolitik, die nicht einem blinden Wachstum folgt, sondern der Erneuerung unseres Wohlstands dient.
Private Investitionen sollen gezielt angereizt werden, etwa durch verbesserte steuerliche Abschreibungsregelungen wie die degressive Afa und Superabschreibungen. Diese Impulse stärken antizyklisch die wirtschaftliche Dynamik. Zusätzlich strebt die Bundesregierung die Entwicklung eines Industriestrompreises an, damit die Industrie auch in der Transformation wettbewerbsfähig bleibt. Auch steht der Abbau von unnötiger Bürokratie im Fokus, damit Verfahren schneller werden. Um die Resilienz in Krisen zu stärken, will die Bundesregierung Lagerhaltung steuerlich fördern.
Ein wesentlicher Faktor für den Investitions- und Industriestandort Deutschland ist die Fachkräftsicherung. Im Zuge der Fachkräftestrategie will die Bundesregierung dafür den Zuzug von Fachkräften über ein modernes Einwanderungsgesetz stärken. Auch gilt es, die inländischen Potentiale bei Teilzeit und freiwillig längerer Arbeit im Alter heben.
3. Strategische Souveränität stärken, Handelspolitik neu ausrichten
Um den Wohlstand in Deutschland und Europa zu bewahren und zu erneuern, stärkt die Bundesregierung die strategische Souveränität und die wirtschaftliche Resilienz in Deutschland und der Europäischen Union. Hierfür bedarf es bilateraler EU-Handelsabkommen auf der Basis starker sozialer und ökologischer Standards, die europäisch und international vorantreibt. Außerdem arbeitet sie intensiv mit ihren Partnern in der EU an europäischen Initiativen wie Clean Tech Europe.
Themen:
LESEN SIE AUCH
OECD senkt Wachstumsprognose – strukturelle Schwächen dämpfen wirtschaftliche Dynamik
Steigende CO₂-Preise: Erhöhte Belastungen für Verbraucher und Wirtschaft ab 2027
Erster Silberstreif am Horizont für die deutsche Konjunktur
Arbeitskosten: Deutschland auf Platz sechs in der EU
Unsere Themen im Überblick
Themenwelt
Wirtschaft
Management
Recht
Finanzen
Assekuranz
Der digitale Führerschein: Ambition trifft auf Realität
Elterngeldbezug rückläufig – Geburtenrückgang und ökonomische Unsicherheiten als zentrale Einflussfaktoren
Haushaltspaket treibt Bundesanleihen in die Höhe
Weniger Niedriglöhne, kleineres Lohngefälle – Deutschland verdient besser
Die neue Ausgabe kostenlos im Kiosk
Werfen Sie einen Blick in die aktuelle Ausgabe und überzeugen Sie sich selbst vom ExpertenReport. Spannende Titelstories, fundierte Analysen und hochwertige Gestaltung – unser Magazin gibt es auch digital im Kiosk.