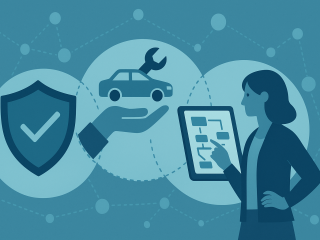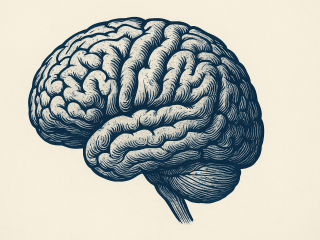Nachdem die Arbeitskosten im ersten und insbesondere dem zweiten Corona-Jahr in Deutschland und den meisten EU-Ländern lediglich langsam gestiegen waren, haben sie sich 2022 deutlich stärker erhöht. Im Zuge von Energiepreisschocks und sehr starker Inflation waren europaweit die größten Zuwächse seit Beginn der 2000er Jahre zu verzeichnen.
So stiegen die Arbeitskosten je Arbeitsstunde in der Privatwirtschaft in Deutschland um jahresdurchschnittlich 6,4 Prozent. Dabei fiel die Zunahme im Dienstleistungsbereich, der traditionell vergleichsweise niedrige Arbeitskosten hat, deutlich stärker aus als in der Industrie. Dazu hat auch die Mindestlohnerhöhung beigetragen, durch die gleichzeitig der Niedriglohnsektor in Deutschland geschrumpft ist.
In der EU legten die Arbeitskosten um 5,4 Prozent zu und im Euroraum um 5,0 Prozent. Gleichzeitig erlitten die Beschäftigten europaweit im Durchschnitt Reallohnverluste, während viele große Unternehmen mit hohen Gewinnen abschlossen. Mit Arbeitskosten von 40 Euro in der Privatwirtschaft rangiert die Bundesrepublik weiterhin im oberen Mittelfeld Westeuropas erneut auf Position sechs unmittelbar vor Österreich.
Das zeigt der neue Report des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung zu den Arbeits- und Lohnstückkosten.
„Wir durchlaufen eine Phase der wirtschaftlichen Zuspitzungen, und die haben 2022 wie wenige andere Jahre geprägt“, sagt Prof. Dr. Sebastian Dullien, der wissenschaftliche Direktor des IMK. Schmerzhafte Reallohnverluste, deutlich höhere Arbeitskosten, brüchige Lieferketten, wachsende Dividenden bei vielen DAX-Konzernen und ein stabiler Arbeitsmarkt – all dies nur in einem Jahr. Er zieht den Schluss:
So verwirrend und teilweise beunruhigend das Bild wirkt, kann man bislang ein relativ positives Zwischenfazit ziehen.
Die meisten europäischen Länder und insbesondere Deutschland seien bislang recht stabil durch diese Krise gekommen und außenwirtschaftlich weiterhin sehr wettbewerbsfähig, weiß der Ökonom. Im laufenden Jahr müsse zwar mit einer leichten Schrumpfung beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) gerechnet werden. Aber angesichts der großen Belastungen wäre viel Schlimmeres möglich gewesen.
Dullien führt das neben einer funktionierenden Sozialpartnerschaft auch auf die Anti-Krisen-Politik der Bundesregierung zurück: „Sie hat die Energieversorgung abgesichert und Bürgerinnen und Bürger sowie die Unternehmen an wichtigen Stellen entlastet. Jetzt ist es wichtig, dass sie diesen Kurs fortsetzt – mit einer Verlängerung der Energiepreisbremsen bis ins nächste Frühjahr ebenso wie etwa mit der Initiative für einen Industriestrompreis zur Standortsicherung in der Transformation.“
Kein Grund zur Sorge
Mittelfristige Stabilität bei kurzfristigen Ausschlägen hat nach der neuen Analyse des IMK auch die Entwicklung der Lohnstückkosten geprägt. Diese sind 2022 in Deutschland zwar um 3,8 Prozent gestiegen und damit etwas stärker als im Euroraum (3,3 Prozent). „Ein Grund zur Sorge ist das dennoch nicht“, betonen Dr. Ulrike Stein und Prof. Dr Alexander Herzog-Stein, die die neue Studie verfasst haben. „Die deutsche Wettbewerbsposition ist weiter unverändert.“
So stiegen die deutschen Lohnstückkosten im Durchschnitt der vergangenen drei Jahre um jährlich 2,4 Prozent, und damit langsamer als im Euroraum insgesamt (2,5 Prozent). Auf die längere Frist gesehen liegt die Lohnstückkostenentwicklung der deutschen Wirtschaft sogar trotz der Beschleunigung 2022 weiterhin deutlich unterhalb der Zielinflation der Europäischen Zentralbank. Zudem hätten auch viele außereuropäische Wettbewerber 2022 erhebliche Steigerungen bei den Lohnstückkosten verzeichnet.
Ein weiteres Indiz ist für die Forschenden die Leistungsbilanz der Bundesrepublik: Sie wies im vergangenen Jahr trotz aller Preisschocks bei Energie- und anderen Importen einen erheblichen Überschuss von vier Prozent des BIP auf. In diesem und im kommenden Jahr dürfte der Überschuss mit fallenden Energiepreisen wieder zunehmen. Die EU-Kommission ordnet Leistungsbilanzüberschüsse ab sechs Prozent als problematisch hoch ein.
Detaillierte Ergebnisse der neuen Studie:
Arbeitskosten: Unverändert Position sechs in der EU
Zu den Arbeitskosten zählen neben dem Bruttolohn die Arbeitgeberanteile an den Sozialbeiträgen, Aufwendungen für Aus- und Weiterbildung sowie als Arbeitskosten geltende Steuern. Das IMK nutzt für seine Studie die neuesten verfügbaren Zahlen der europäischen Statistikbehörde Eurostat. Diese hat ihre Statistik zuletzt auf eine neue Berechnungsgrundlage umgestellt, was das Niveau der EU-Arbeitskosten erhöht, aber nicht die Entwicklungsraten. Da Eurostat auch für das Jahr 2021 revidiert hat, sind die Daten aus dem IMK-Arbeitskostenreport 2021 nicht mehr relevant.
Die Arbeitskosten in der deutschen Privatwirtschaft sind 2022 nominal um 6,4 Prozent gestiegen, nach nur 1,3 Prozent 2021. Mit Arbeitskosten von 40,00 Euro pro Stunde lag Deutschland 2022 an sechster Stelle unter den EU-Ländern hinter Luxemburg, Dänemark, Belgien, Schweden und Frankreich (Arbeitskosten dort zwischen 50,40 und 41,10 Euro).
Mit nur geringfügig niedrigeren Arbeitskosten als Deutschland folgen Österreich mit aktuell 39,30 Euro und die Niederlande mit 39,10 Euro pro Stunde. Der Durchschnitt des Euroraums beträgt 34,10 Euro. Italien weist mit 28,40 Euro die höchsten Arbeitskosten in Südeuropa auf, liegt aber nach wie vor im Jahr 2022 spürbar unter dem EU-Mittel von 30,20 Euro. In den übrigen südlichen EU-Staaten betragen die Arbeitskosten zwischen 22,90 Euro (Spanien) und 15,20 Euro (Griechenland).
Die „alten“ EU-Länder Portugal und Griechenland liegen mittlerweile zum Teil deutlich hinter osteuropäischen EU-Staaten wie Slowenien (23,50 Euro), Estland (16,60 Euro), der Tschechischen Republik (16,20 Euro) oder der Slowakei (15,70 Euro). In den übrigen baltischen Staaten, Polen, Kroatien und Ungarn betragen die Stundenwerte zwischen 13,20 und 11,10 Euro. Schlusslichter sind Rumänien und Bulgarien mit Arbeitskosten von 9,30 bzw. 8,00 Euro pro Stunde, allerdings bei überdurchschnittlichen Zuwächsen von 14,2 und 16,7 Prozent im vergangenen Jahr.
Arbeitskosten bei Industrie und Dienstleistungen
Im Verarbeitenden Gewerbe betrugen 2022 die Arbeitskosten in Deutschland 44,00 Euro pro Arbeitsstunde. Im EU-Vergleich rangiert die Bundesrepublik damit wie im Vorjahr auf Position vier als Teil einer größeren Gruppe von Industrieländern, die deutlich über dem Euroraum-Durchschnitt von 36,20 Euro liegen. Dazu zählen auch Dänemark mit industriellen Arbeitskosten von 49,80 Euro, Belgien (46,30 Euro), Schweden (44,80 Euro) sowie Österreich und Luxemburg (je 43,00 Euro), Frankreich (42,90 Euro), die Niederlande (42,80 Euro) und Finnland (40,10 Euro).
Dabei ist nicht berücksichtigt, dass das Verarbeitende Gewerbe in der Bundesrepublik vergleichsweise stark von günstigeren Vorleistungen aus dem Dienstleistungsbereich profitiert – auch wenn es im vergangenen Jahr eine gewisse Annäherung gab. 2022 stiegen die industriellen Arbeitskosten in Deutschland um 4,5 Prozent. Das war etwas schwächer als im Durchschnitt der EU (4,8 Prozent) und leicht stärker als im Euroraum (4,3 Prozent).
Im privaten Dienstleistungssektor lagen die deutschen Arbeitskosten 2022 mit 38,00 Euro an sechster Stelle nach Luxemburg, Dänemark Schweden, Belgien und Frankreich, wo die Stundenwerte zwischen 55,30 Euro und 40,70 Euro lagen. Auch bei den Dienstleistungen folgten die Niederlande (37,80 Euro) und Österreich (37,40 Euro) sehr nah auf die Bundesrepublik, 2021 hatten sie leicht vor beziehungsweise gleichauf mit Deutschland gelegen.
Der Durchschnitt im Euroraum betrug 33,30 Euro, in der gesamten EU 30,20 Euro. 2022 stiegen die Arbeitskosten im deutschen Dienstleistungssektor um 7,2 Prozent. Damit lag der Zuwachs spürbar über dem Durchschnitt in der EU (5,5 Prozent) und im Euroraum (5,2 Prozent). Ein wichtiger Grund für die ungewöhnlich starke Zunahme hierzulande dürfte die Mindestlohnanhebung auf 12 Euro gewesen sein.
„Das ist eine positive Entwicklung, da Deutschland nach wie vor den höchsten Lohnabstand zwischen Verarbeitendem Gewerbe und Dienstleistungssektor aufweist“, schreiben Stein und Herzog-Stein. Durch die Erhöhung wurden Beschäftigte mit niedrigen Entgelten nach einer IMK-Studie vor Kaufkraftverlusten bewahrt, laut Daten des Statistischen Bundesamtes ist der in Deutschland seit Jahren recht große Niedriglohnsektor dadurch deutlich kleiner geworden.
Lohnstückkostenentwicklung: Langfristig unter dem Euroraum-Mittel
Bei den Lohnstückkosten, die die Arbeitskosten ins Verhältnis zum Produktivitätsfortschritt setzen, weist Deutschland trotz der stärkeren Steigerung 2022 längerfristig weiterhin eine moderate Tendenz auf. Der Blick auf den mehrjährigen Trend ist nach Analyse der IMK-Ökonom*innen am aussagekräftigsten, um die Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit zu beurteilen.
Die deutschen Lohnstückkosten sind seit der Jahrtausendwende, als die Bundesrepublik letztmalig eine fast ausgeglichene Leistungsbilanz aufwies (seitdem immer Überschüsse), im Jahresmittel um lediglich 1,4 Prozent gewachsen. Das ist schwächer als in den anderen großen Mitgliedsstaaten des Euroraums und weitaus weniger als mit dem Inflationsziel der EZB von 2,0 Prozent vereinbar gewesen wäre.
Die langfristige deutsche Lohnstückkostenentwicklung seit der Jahrtausendwende lag Ende 2022 laut IMK immer noch um kumuliert 6,2 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt des Euroraums.
Während man die in den letzten Jahren dynamischere Entwicklung in Deutschland somit als Teil eines Normalisierungsprozesses verstehen könne, raten Stein und Herzog-Stein, die Lohnstückkostenentwicklungen in der Eurozone im Auge zu behalten. So lägen sie beispielsweise in den baltischen Staaten mit durchschnittlichen jährlichen Anstiegen zwischen knapp sechs und gut acht Prozent über die vergangenen drei Jahre weit über dem Inflationsziel der EZB.
Anhaltend divergierende Lohnstückkostenentwicklungen könnten zu neuen Ungleichgewichten im Euroraum führen, wie sie vor knapp zwei Jahrzehnten zur Eurokrise beigetragen haben, warnen die Forschenden. Und es könnte weitere Zinserhöhungen der Zentralbank provozieren, die auch die Konjunktur in den übrigen Euroländern treffen würden.
Themen:
LESEN SIE AUCH
Inflations-Monitor: Ungleiche Lastenverteilung
Arbeitskosten trotz Kurzarbeit-Effekt unterdurchschnittlich gestiegen
Rezessionswahrscheinlichkeit weiterhin im roten Bereich
Zwar ist für den Zeitraum von August bis Ende Oktober die Rezessionswahrscheinlichkeit um 7 Prozentpunkte auf 71,5 Prozent gesunken. Doch liegt dieser Wert weiter über der Grenze, ab der der nach dem Ampelsystem arbeitende IMK-Konjunkturindikator eine akute Rezessionsgefahr („rot“) markiert.
IMK-Konjunkturindikator auf „gelb-grün“
Die Wahrscheinlichkeit, dass die deutsche Wirtschaft in nächster Zeit in eine Rezession gerät, ist in den vergangenen Wochen geringfügig gestiegen, bleibt aber auf relativ niedrigem Niveau. Für die Zeit von Anfang März bis Ende Mai beziffert der Konjunkturindikator dieses Risiko mit 23 Prozent.
Unsere Themen im Überblick
Themenwelt
Wirtschaft
Management
Recht
Finanzen
Assekuranz
Sportunfälle 2024: ERGO veröffentlicht neue Unfallstatistik pünktlich zur Frauen-EM
Fußball, Skisport, E-Bikes – wo Sport zur Gefahr wird: Die neue Unfallstatistik von ERGO zeigt, welche Sportarten 2024 besonders viele Verletzungen verursacht haben. Wer denkt, es trifft nur die Profis, liegt falsch. Besonders auffällig: Eine beliebte Sommersportart ist aus den Top Ten verschwunden.
BaFin deckt Beratungsmängel bei Versicherungsanlageprodukten auf
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat bei einer Mystery-Shopping-Aktion deutliche Defizite bei der Beratung und Dokumentation im Vertrieb von Versicherungsanlageprodukten festgestellt. Das geht aus einem Bericht hervor, den die Aufsicht jetzt veröffentlicht hat. Die Aktion war Teil einer europaweiten Untersuchung, die von der Europäischen Aufsichtsbehörde EIOPA koordiniert wurde und zwischen März und Juni 2024 stattfand.
Altersdiskriminierung trifft nicht nur die Älteren – neue Studie überrascht mit Ergebnissen
Die neueste Ausgabe der DIA-Studie 50plus rückt ein bislang wenig beachtetes Phänomen ins Licht: Jüngere Menschen berichten deutlich häufiger von Altersdiskriminierung als Ältere.
Künstliche Intelligenz auf dem Vormarsch – doch nicht alle Branchen ziehen mit
Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der deutschen Wirtschaft nimmt spürbar zu. Inzwischen setzen rund 41 Prozent der Unternehmen auf KI-gestützte Prozesse. Besonders große Firmen und technologieaffine Branchen treiben die Entwicklung voran – doch es gibt auch Zurückhaltung.
Die neue Ausgabe kostenlos im Kiosk
Werfen Sie einen Blick in die aktuelle Ausgabe und überzeugen Sie sich selbst vom ExpertenReport. Spannende Titelstories, fundierte Analysen und hochwertige Gestaltung – unser Magazin gibt es auch digital im Kiosk.