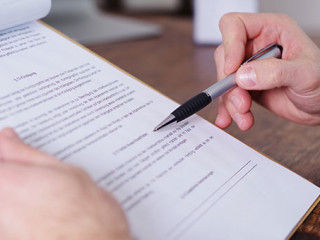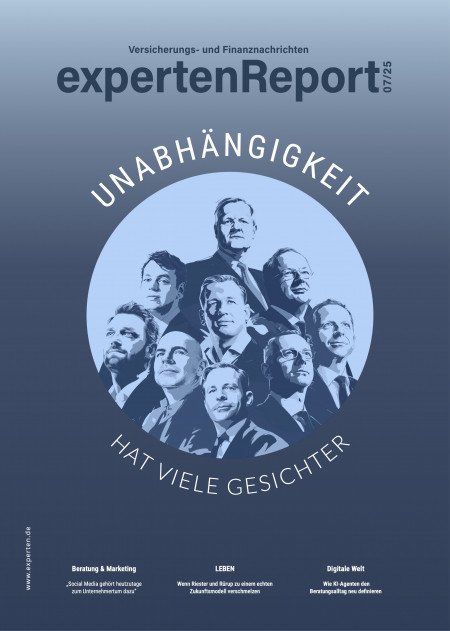Das Kammergericht Berlin stellt mit Hinweisbeschluss vom 09. Oktober 2018 (Az: 6 U 64/18) äußerst anschaulich die formellen und materiellen Voraussetzungen einer Leistungseinstellung einer Berufsunfähigkeitsversicherung im Nachprüfungsverfahren dar.
Dabei werden (auch) die Kriterien für den in einem Nachprüfungsverfahren vorzunehmenden Vergleich zwischen dem Gesundheitszustand bei vertraglichem Anerkenntnis und demjenigen im Nachprüfungsverfahren verdeutlicht.
Leistungseinstellung im Nachprüfungsverfahren
In dem zugrundeliegenden Fall wurde eine Versicherungsnehmerin, die als Altenpflegerin tätig war, berufsunfähig. Ihr Berufsunfähigkeitsversicherer gab auf der Basis der von ihr eingereichten Unterlagen ein entsprechendes Leistungsanerkenntnis ab und verpflichtete sich damit die vertragsgemäßen Leistungen zu erbringen.
Im Rahmen des von dem Versicherer durchgeführten Nachprüfungsverfahrens erklärte dieser jedoch die Einstellung seiner zuvor erbrachten Leistungen. In seinem Einstellungsschreiben gab der Versicherer den – von Gutachtern festgestellten – Gesundheitszustand der Versicherungsnehmerin nicht im Einzelnen wieder. Er bezog sich jedoch in dem Schreiben auf den Inhalt der Gutachten und fügte diese in Kopie bei. Weiterhin beschrieb er die sich aus den gesundheitlichen Verbesserungen ergebenden Auswirkungen auf die berufliche Leistungsfähigkeit, indem er die einzelnen ausführbaren Teiltätigkeiten benannte.
Die Versicherungsnehmerin wandte ein, dass sich aus dem Verweis auf die beigefügten Anlagen nicht ergebe, welche beiden Stadien des Gesundheitszustands der Versicherungsnehmerin miteinander verglichen worden sei. Sie begehrte von ihrem Berufsunfähigkeitsversicherer weitere Leistungen aus dem bestehenden Berufsunfähigkeitsversicherungsvertrag.
Die Entscheidung des KG Berlin
Das Kammergericht Berlin stellte in seiner Entscheidung klar, dass in dem zugrundeliegenden Fall die formellen und materiellen Voraussetzungen für eine Leistungseinstellung des Versicherers vorlagen. Der Versicherer hatte nach Ansicht des Gerichts formell und materiell wirksam eine Leistungseinstellung erklärt. Der Versicherer erbrachte infolgedessen zu Recht keine weiteren vertraglichen Leistungen mehr.
Für das Gericht stand insbesondere aufgrund der vom Versicherer vorgenommenen Vergleichsbetrachtung fest, dass die Berufsunfähigkeit der Versicherungsnehmerin sich im Sinne der Besonderen Bedingungen zur Berufsunfähigkeitsversicherung (BB-BUZ) im Zeitraum zwischen Leistungsanerkenntnis und Nachprüfungsverfahren auf weniger als 50 % gemindert hatte.
Formelle Voraussetzung einer Leistungseinstellung
In formeller Hinsicht muss der Versicherer für eine wirksame Leistungseinstellung der Versicherungsnehmerin nachvollziehbar mitteilen und begründen, dass und aufgrund welcher Umstände seine zunächst anerkannte Leistungspflicht wieder endet. Damit soll ein Versicherungsnehmer mit den erforderlichen Informationen ausgestattet werden, um sein Prozessrisiko für eine Klage auf Fortsetzung der Leistungen abschätzen zu können. Laut KG Berlin genügt das vorliegende Einstellungsschreiben des Versicherers diesen formellen Anforderungen. Für die Versicherungsnehmerin war (dadurch) nachvollziehbar, weshalb die Leistungspflicht des Versicherers wieder enden sollte.
Das KG Berlin stellt klar, dass es unschädlich ist, dass der Versicherer den Gesundheitszustand der Versicherungsnehmerin nicht im Einzelnen in dem Einstellungsschreiben wiedergegeben hat. Die Bezugnahme auf den Inhalt der beigefügten Gutachten genügt. Eine explizit vergleichende Darstellung der beruflichen Leistungsfähigkeit zum Zeitpunkt des Anerkenntnisses bedurfte es laut KG ebenfalls nicht. Es genügt die Beschreibung der sich aus den gesundheitlichen Verbesserungen ergebenden Auswirkungen auf die berufliche Leistungsfähigkeit der Versicherungsnehmerin durch Benennung der einzelnen ausführbaren Teiltätigkeiten.
Materielle Voraussetzung einer Leistungseinstellung
Die materielle Voraussetzung einer Leistungseinstellung bedeutet, dass sich der Gesundheitszustand der Versicherungsnehmerin seit dem Leistungsanerkenntnis so gebessert hat, dass die Berufsunfähigkeit weggefallen ist oder sich ihr Grad mindestens auf unter 50% gemindert hat.
Das KG Berlin stellt klar, dass es für den Nachweis einer Gesundheitsbesserung unschädlich ist, wenn der tatsächlich bestandene Gesundheitszustand der Versicherungsnehmerin nicht mehr rückwirkend festgestellt werden kann. Vergleichsmaßstab ist der Gesundheitszustand, auf deren Grundlage der Versicherer das Anerkenntnis erklärt hat und nicht der etwaig abweichende, tatsächliche Gesundheitszustand. In diesem Zusammenhang kann sich ein Versicherter nachträglich auch nicht auf die Unrichtigkeit der dem Anerkenntnis zugrundeliegenden ärztlichen Befunde berufen.
Vorliegend hatte der Versicherer sein Leistungsanerkenntnis auf Grundlage der von der Versicherungsnehmerin vorgelegten Unterlagen erklärt, wonach diese aus orthopädischer und psychiatrischer Sicht in ihrem Beruf als Altenpflegerin arbeitsunfähig war. Hiervon ist in der Vergleichsprüfung auszugehen. Für den Zeitpunkt der Nachprüfungsentscheidung legte der Versicherer Gutachten zugrunde, wonach die Arbeitsfähigkeit der Versicherungsnehmerin bescheinigt wurde.
Fazit und Praxishinweis
Eine Leistungseinstellung des Versicherers nach Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens unterliegt formalen und materiellen Voraussetzungen. Im Rahmen der materiellen Voraussetzung trägt der Versicherer die Beweislast für den Wegfall der Berufsunfähigkeit. Der Beweis ist dem Versicherer in dem vorliegenden Fall jedoch gelungen. Dieses ist nicht immer der Fall, betrachtet man gerade das Urteil des OLG Saarbrücken vom 07.04.2017 – Az. 5 U 32/14.
Wie man an dieser vorliegenden Entscheidung sieht, ist jedes Nachprüfungsverfahren ein Einzelfall. Sowie auch jedes BU-Verfahren an sich. Gerade, wenn der Versicherte wieder neue Tätigkeiten aufnimmt und diese tatsächlich ausübt, könnte der Versicherer im Zweifel sogar auch im Rahmen des Nachprüfungsverfahrens eine konkrete Verweisung aussprechen. Diese natürlich nur, wenn die neue Tätigkeit der vormaligen Lebensstellung entspricht (vgl. OLG Jena v. 21.12.2017 – Az. 4 U 699/13) und zum Beispiel keine unzulässige Verweisung auf neu erworbene Fähigkeiten im Nachprüfungsverfahren vorliegt (vgl. LG Nürnberg-Fürth v. 14.12.2017 – Az. 2 O 3404/16). Diese Verweisung des Versicherers sollte wiederum im Einzelfall genauestens anwaltlich überprüft werden, da sonst die vertraglich zugesicherten Ansprüche des Versicherten vereitelt werden könnten.
Björn Thorben M. Jöhnke, Fachanwalt für Versicherungsrecht, Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz, Kanzlei Jöhnke & Reichow Rechtsanwälte in Partnerschaft mbB
Themen:
LESEN SIE AUCH
Vier von fünf BU-Entscheidungen zugunsten der Versicherten
BU: Nachprüfungsverfahren auch bei unterlassenem Leistungsanerkenntnis notwendig
BU-Urteil: Unzulässige Verweisung auf neu erworbene Fähigkeit im Nachprüfungsverfahren
Versicherer muss ungeschwärztes Gutachten übermitteln
Unsere Themen im Überblick
Themenwelt
Wirtschaft
Management
Recht
Finanzen
Assekuranz
BGH: Staat haftet für mögliche Impfschäden – nicht die Ärztin
Eigentumsrecht vor Wohngewohnheit: Verfassungsgericht stärkt Kündigungsrecht bei Verwahrlosung
BVerfG bestätigt Verfassungsmäßigkeit der Mindestgewinnbesteuerung
Verfassungsgericht kippt finanzgerichtliche Entscheidungen zur beSt-Nutzungspflicht
Die neue Ausgabe kostenlos im Kiosk
Werfen Sie einen Blick in die aktuelle Ausgabe und überzeugen Sie sich selbst vom ExpertenReport. Spannende Titelstories, fundierte Analysen und hochwertige Gestaltung – unser Magazin gibt es auch digital im Kiosk.