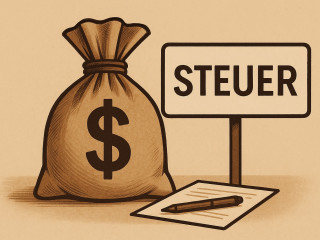Langsamer Niedergang: Experten schlagen Alarm – Deutschlands Wirtschaft am Scheideweg
Eine ernüchternde Bilanz der deutschen Wirtschaft hat das Wirtschaftsteam von Bloomberg Economics im Dezember veröffentlicht. Die Analyse zeigt auf, dass die deutsche Wirtschaft nicht nur mit kurzfristigen Problemen, sondern mit einem drohenden strukturellen Abwärtstrend konfrontiert ist, der als „unumkehrbar“ bezeichnet wird. Nach fünf Jahren weitgehender Stagnation ist die deutsche Wirtschaftsleistung inzwischen fünf Prozent kleiner, als sie es ohne den Pandemie-bedingten Einbruch und strukturelle Herausforderungen hätte sein können.
„Deutschland bricht nicht über Nacht zusammen“, zitiert Bloomberg Amy Webb, Geschäftsführerin des Future Today Institute. „Es ist ein sehr langsamer, sehr langwieriger Niedergang. Nicht eines Unternehmens, nicht einer Stadt, sondern eines ganzen Landes – und Europa wird mit in den Abgrund gezogen.“
Stagnation und strukturelle Probleme
Seit 2019 hat Deutschland laut Bloomberg Economics einen Wachstumsrückgang von fünf Prozent verzeichnet, der schwer aufzuholen sein wird. Neben der Pandemie und geopolitischen Krisen sieht die Analyse grundlegende strukturelle Probleme, die den Abwärtstrend verfestigen. Die schwindende Wettbewerbsfähigkeit, steigende Produktionskosten und der Verlust von günstigem russischem Gas werden als zentrale Herausforderungen genannt. Besonders betroffen ist die Automobilindustrie, die seit Jahren mit der Umstellung auf Elektromobilität, einem starken Wettbewerb aus China und innerbetrieblichen Konflikten kämpft.
Die Folgen für die Haushalte sind spürbar: Schätzungen von Bloomberg Economics zufolge verlieren deutsche Haushalte aufgrund der wirtschaftlichen Schwäche jährlich etwa 2500 Euro. Diese Entwicklung ist nicht nur ein Problem für den Konsum, sondern verschärft soziale Spannungen und erhöht die politische Unsicherheit.
Deindustrialisierung und Beschäftigungsverluste
Ein weiterer zentraler Punkt der Kritik ist die zunehmende Deindustrialisierung Deutschlands. Energieintensive Industrien fahren ihre Produktion zurück, während Unternehmen angesichts steigender Kosten und hoher regulatorischer Belastungen weniger im Inland investieren. Laut Stefan Koopman, Senior-Makrostratege bei der Rabobank, erfordert diese Entwicklung ein grundlegendes Überdenken dessen, was die „deutsche Wirtschaft“ ausmacht. „Bisher gibt es kaum Anzeichen dafür, dass ein solcher Wandel stattfindet“, kritisierte er in einer Analyse.
Auch der Arbeitsmarkt bleibt unter Druck. Die Arbeitslosenquote wird laut aktuellen Berichten im Jahr 2024 bei sechs Prozent liegen – der höchste Stand seit 2016. Große Unternehmen wie Thyssenkrupp, Bosch, Schaeffler und Ford haben umfangreiche Stellenstreichungen angekündigt, während Volkswagen bis 2030 über 35.000 Arbeitsplätze abbauen will. Der Verband der Automobilindustrie (VDA) schätzt, dass die Beschäftigung in der Branche bis 2035 um 186.000 Stellen sinken könnte, wenn der aktuelle Trend anhält.
Arbeitsmarktexperte Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) betonte, dass die Verluste in traditionellen Branchen nicht ausreichend durch neue Arbeitsplätze in innovativen Bereichen kompensiert werden. „Je länger die Unsicherheit vorherrscht, desto weniger werden Unternehmen bereit sein, ihre Beschäftigten zu halten oder neue Stellen zu schaffen“, warnte Weber.
Neuwahlen als Hoffnungsschimmer – doch das Risiko bleibt
Die für Februar 2024 geplanten vorgezogenen Neuwahlen bieten laut Bloomberg Economics eine Chance auf einen wirtschaftspolitischen Kurswechsel. Doch die Autoren der Analyse warnen, dass die deutsche Politik möglicherweise nicht die nötige Dringlichkeit an den Tag legt, um die zentralen Herausforderungen entschlossen anzugehen. Eine Politik der kleinen Schritte könne den langfristigen Abwärtstrend nicht aufhalten.
Achim Wambach, Präsident des ZEW-Instituts, sieht in den Neuwahlen dennoch einen möglichen Wendepunkt. „Mit den vorgezogenen Neuwahlen in Deutschland und den daraus resultierenden Erwartungen an eine wirtschaftspolitische Förderung privater Investitionen sowie der Aussicht auf weitere Zinssenkungen verbessert sich der wirtschaftliche Ausblick“, sagte er laut Bloomberg. Der ZEW-Index für Konjunkturerwartungen stieg im Dezember überraschend deutlich von 7,4 auf 15,7 Punkte und übertraf damit die Prognosen aller Analysten.
Dennoch bleibt die Unsicherheit hoch. Die Bildung einer stabilen Regierung wird entscheidend sein, um dringend benötigte Reformen umzusetzen. Langwierige Koalitionsverhandlungen oder ein schwacher politischer Konsens könnten die wirtschaftliche Erholung zusätzlich verzögern.
Perspektiven für die Zukunft
Laut Bloomberg Economics könnte Deutschlands Abwärtstrend nicht nur die deutsche Wirtschaft, sondern ganz Europa belasten. Der Rückgang des Lebensstandards und die daraus resultierenden sozialen Spannungen könnten dazu führen, dass dringend benötigte internationale Talente das Land meiden – ein Risiko, das langfristige Auswirkungen auf Wachstum und Innovation haben könnte.
Trotz der düsteren Aussichten bleibt ein Hoffnungsschimmer: Deutschland verfügt nach wie vor über die niedrigste Schuldenquote unter den G7-Staaten, was Spielraum für Investitionen bietet. Laut Bloomberg könnten gezielte öffentliche Investitionen in Schlüsselbereiche wie Digitalisierung, erneuerbare Energien und Infrastruktur dazu beitragen, die Wettbewerbsfähigkeit wiederherzustellen.
Doch die Zeit drängt. Salomon Fiedler, Ökonom bei der Privatbank Berenberg, warnte, dass eine moderate wirtschaftliche Erholung mittelfristig von der Politik nicht als Grund für Selbstzufriedenheit interpretiert werden dürfe. „Die grundlegenden Herausforderungen Deutschlands erfordern tiefgreifende Reformen – und der politische Wille dazu muss dringend unter Beweis gestellt werden“, so Fiedler.
Fazit
Die aktuelle Analyse von Bloomberg Economics zeichnet ein alarmierendes Bild der deutschen Wirtschaft: ein schleichender Niedergang, der durch strukturelle Schwächen, politische Unsicherheiten und externe Schocks geprägt ist. Die kommenden Monate und insbesondere die Ergebnisse der Neuwahlen im Februar könnten entscheidend dafür sein, ob Deutschland die Weichen für eine langfristige Stabilisierung und Erholung stellt – oder ob es weiter auf einem Abwärtspfad verbleibt, der schwer zu korrigieren sein wird.
Themen:
LESEN SIE AUCH
Bekommt das zarte Pflänzchen Aufschwung genug Platz?
Deutschland erlebt im Frühsommer 2025 erste zaghafte Zeichen wirtschaftlicher Erholung. Doch reicht das aus, um den Aufschwung dauerhaft zu tragen? Der Monatsbericht des BMWK gibt sich hoffnungsvoll, warnt jedoch vor strukturellen Risiken. Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing mahnt: Ohne einen starken europäischen Kapitalmarkt fließen die großen Geldströme weiter an uns vorbei. Ein makroökonomischer Blick auf Chancen, Hürden – und die Frage, ob das zarte Pflänzchen wirklich Wurzeln schlagen kann.
Trump lässt jetzt schon die Märkte wackeln – Wohin geht die Reise?
Noch vor seiner offiziellen Amtsübernahme sorgt Donald Trump bereits für Bewegung an den Finanzmärkten. Nachdem ein Bericht der Washington Post andeutete, dass Trumps geplante Zölle möglicherweise weniger breit ausfallen könnten als im Wahlkampf angekündigt, brach der US-Dollar am Montag zunächst ein.
Allianz Trade: Mini-Wachstum 2025 – doch Deutschlands Resilienz lässt auf mehr hoffen
Trotz schleppender Weltkonjunktur sieht Allianz Trade Deutschland auf dem Weg zur wirtschaftlichen Erholung – sofern Digitalisierung, Klimainvestitionen und Strukturreformen entschlossen vorangetrieben werden.
Fiskalische Zeitenwende oder riskante Halse? Deutschlands Investitions- und Verteidigungskurs im Stresstest
Deutschland steht vor einem wirtschafts- und sicherheitspolitischen Kraftakt historischen Ausmaßes. Mit einem 500-Milliarden-Euro-Investitionspaket und dem Ziel, die Verteidigungsausgaben auf 3,5 % des BIP zu steigern, wagt die Bundesregierung eine fiskalische Zeitenwende. Doch der Spagat zwischen Wachstumsimpulsen, geopolitischer Abschreckung und haushaltspolitischer Stabilität ist riskant – ökonomisch wie gesellschaftlich.
Unsere Themen im Überblick
Themenwelt
Wirtschaft
Management
Recht
Finanzen
Assekuranz
Stromsteuer-Senkung bleibt aus: Verbraucher außen vor
Die Bundesregierung verabschiedet sich von ihrem Versprechen, die Stromsteuer für alle Verbraucher auf das EU-Mindestmaß zu senken. Nur Industrie und Landwirtschaft sollen entlastet werden. Während Ministerin Reiche von „finanzieller Wirklichkeit“ spricht, wirft der Steuerzahlerbund der Regierung einen Wortbruch vor. Die Entscheidung trifft besonders Mittelstand und Haushalte – und beschädigt die politische Glaubwürdigkeit der Ampel.
Ertragsteuern im Rückwärtsgang – aber Lohn- und Umsatzsteuer stabilisieren die Einnahmelage
Wie das Bundesfinanzministerium im Monatsbericht Juni 2025 mitteilt, hat sich das Steueraufkommen im Mai weiter positiv entwickelt – mit einer wichtigen Ausnahme: Die Ertragsteuern geraten spürbar unter Druck. Während Lohn- und Umsatzsteuer verlässlich tragen, wirft der Rückgang bei den ertragsbezogenen Einnahmen Fragen nach der konjunkturellen Substanz auf.
Krisenzeiten hinterlassen Spuren: Finanzielle Engpässe vor allem bei älteren Verbrauchergruppen
Trotz wirtschaftlicher Erholung nach der Corona-Pandemie und dem Beginn des Ukraine-Kriegs bleibt die finanzielle Lage vieler Haushalte angespannt. Welche Verbraucher-Gruppen besonders betroffen sind.

Rückkehr der Negativzinsen? Die SNB steht vor einem geldpolitischen Tabubruch
Am 24. Juli 2025 entscheidet die EZB über den nächsten Zinsschritt. Während die SNB womöglich zurück zu Negativzinsen kehrt, muss sich auch die Euro-Zone auf neue geldpolitische Realitäten einstellen. Kommt der Kurswechsel?
Die neue Ausgabe kostenlos im Kiosk
Werfen Sie einen Blick in die aktuelle Ausgabe und überzeugen Sie sich selbst vom ExpertenReport. Spannende Titelstories, fundierte Analysen und hochwertige Gestaltung – unser Magazin gibt es auch digital im Kiosk.