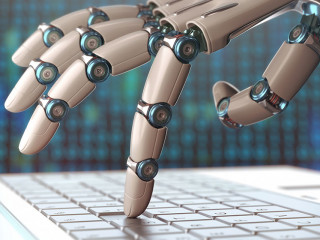Das Jahressteuergesetz 2024 bringt einige Anpassungen, doch echte Reformen bleiben aus. Ute Pappelbaum, Geschäftsführerin der experten-netzwerk GmbH, stellt in ihrem Kommentar heraus, warum die neuen Regelungen eher Stückwerk als großer Wurf sind.
Das Jahressteuergesetz 2024, das der Bundestag am 18. Oktober 2024 verabschiedet hat, wirkt wie ein halbherziger Versuch, an mehreren Stellen kleine Anpassungen vorzunehmen, ohne tiefgreifende Veränderungen zu schaffen. Zwar zielt das Gesetz darauf ab, aktuelle Herausforderungen im Steuerrecht aufzugreifen, doch in zentralen Bereichen bleiben die Regelungen hinter den Erwartungen zurück. Die Zustimmung des Bundesrats am 22. November 2024 steht noch aus, doch die Wirkung des Gesetzes dürfte begrenzt bleiben.
Steuerbefreiung für Photovoltaikanlagen: Ein Tropfen auf den heißen Stein
Mit der Anhebung der steuerfreien Leistung kleiner Photovoltaikanlagen von 15 kW (peak) auf 30 kW (peak) pro Wohn- oder Gewerbeeinheit wird ein kleiner Fortschritt erzielt. Auch Gewerbeimmobilien mit mehreren Einheiten profitieren. Dennoch bleibt der Impuls für den Ausbau erneuerbarer Energien gering, da umfassendere Förderansätze oder Vereinfachungen fehlen.
E-Bilanz: Mehr Bürokratie statt echter Vereinfachung
Die erweiterten Übermittlungspflichten im Rahmen der E-Bilanz belasten Unternehmen stärker, als sie vereinfachen. Neben Kontennachweisen und Anlagenverzeichnissen müssen ab 2028 auch Lageberichte und Prüfungsberichte elektronisch eingereicht werden. Für viele Unternehmen, vor allem kleinere Betriebe, bedeutet dies zusätzlichen Aufwand, ohne erkennbaren Vorteil.
Kinderbetreuungskosten: Leichte Entlastung, aber kein großer Wurf
Die Erhöhung des abziehbaren Anteils bei Kinderbetreuungskosten auf 80 % und die Anhebung des Höchstbetrags auf 4.800 Euro pro Kind ab 2025 schaffen zwar Entlastungen für Familien. Doch diese Maßnahme bleibt Stückwerk und löst keine grundsätzlichen Probleme bei der steuerlichen Förderung von Familien.
Verlustverrechnung: Streitpunkt ohne Lösung
Ein besonders kritischer Punkt bleibt die Verlustverrechnungsbeschränkung bei Termingeschäften. Die Begrenzung der Verrechnung auf 20.000 Euro jährlich und die fehlende Möglichkeit, Verluste breiter auszugleichen, sorgen weiterhin für Unmut. Der Bundesfinanzhof hat die Regelung als verfassungsrechtlich bedenklich eingestuft, doch statt einer Reform wird der Status quo fortgesetzt. Dieser Kompromiss verdeutlicht, dass politische Zurückhaltung wichtiger war als eine umfassende Lösung.
Kleinunternehmerregelung: Mehr Spielraum, aber keine Revolution
Mit der Anhebung der Umsatzgrenzen auf 25.000 Euro im Vorjahr und 100.000 Euro im laufenden Jahr erhalten kleine Unternehmen mehr Freiheiten. Doch auch hier bleibt der Ansatz zu schmal, um wirklich tiefgreifende Entlastungen zu schaffen.
Ein Gesetz ohne Schlagkraft
Das Jahressteuergesetz 2024 liest sich wie ein Versuch, Steuerpolitik ohne Konflikte zu gestalten. Die Änderungen sind an vielen Stellen pragmatisch, aber weit davon entfernt, strukturelle Herausforderungen anzugehen oder gar ein Zeichen für echte Reformbereitschaft zu setzen. Kritische Themen wie die Verlustverrechnung bleiben ungelöst, und selbst die positiven Ansätze wie die Reform der Kleinunternehmerregelung verpuffen in ihrer Wirkung. Es bleibt der Eindruck eines Kompromisses, der mehr der politischen Gesichtswahrung als den steuerlichen Bedürfnissen gerecht wird.
Themen:
LESEN SIE AUCH
Intuitiv, aber nicht trivial – Was Unternehmen beim Einsatz generativer KI übersehen
Was aussieht wie Magie, ist in Wahrheit ein Systemrisiko: Warum Unternehmen bei ChatGPT & Co. dringend mehr Kontrolle als Komfort brauchen, erklärt Diplom-Mathematiker Dirk Pappelbaum (Inveda.net) im Gastbeitrag.
Schwieriger Start für Friedrich Merz in anstrengenden Zeiten
Friedrich Merz startet mit knapper Mehrheit ins Kanzleramt – inmitten wirtschaftlicher Unsicherheit, transatlantischer Spannungen und wachsendem Rechtspopulismus. Um politisch zu bestehen, braucht er mehr als Führung: eine klare Agenda, strategische Mäßigung – und den Mut zum Dialog.
Warum Europas digitaler Tiefschlaf enden muss – und wie der „AI Continent“-Plan zum Wendepunkt werden kann
Die EU will mit dem „AI Continent Plan“ zur globalen KI-Macht aufsteigen – doch reicht das, um den digitalen Rückstand aufzuholen? Ein Kommentar über Europas Weckruf, seine neuen Ambitionen und das, was jetzt wirklich zählt.
Soli bleibt – Bundesverfassungsgericht weist Verfassungsbeschwerde ab
Der Solidaritätszuschlag darf weiter erhoben werden, urteilt das Bundesverfassungsgericht. Eine Klage gegen den sogenannten "Soli" wurde abgewiesen. Zwar sei die Abgabe rechtlich zulässig – doch nur, solange ein konkreter Mehrbedarf des Bundes besteht. Was die Richter vom Gesetzgeber fordern und warum das Thema politisch brisant bleibt.
Unsere Themen im Überblick
Themenwelt
Wirtschaft
Management
Recht
Finanzen
Assekuranz
Steuerfreie Zuschläge: Was sich bei Überstunden ändert
Mehr Netto durch Mehrarbeit? Die Bundesregierung plant steuerfreie Überstundenzuschläge. Doch was bedeutet das konkret – und wo lauern Risiken?
Rentenplus mit Nebenwirkung? Steuerfragen rund um die Erhöhung ab Juli 2025
Mehr Rente ab Juli – aber auch mehr Steuern? Wer jetzt zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet ist, welche individuellen Faktoren entscheidend sind und warum viele Ruheständler trotzdem nichts ans Finanzamt zahlen müssen.
Steuerbonus für energetische Sanierungen
Wer seine eigenen vier Wände energetisch saniert, kann beim Finanzamt kräftig sparen – bis zu 40.000 Euro Steuerbonus sind drin. Doch Vorsicht: Ab 2025 gelten neue Vorgaben für die Bescheinigung der Maßnahmen. Die VLH erklärt, was Hausbesitzer jetzt wissen müssen.
Änderung des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses: Neue Vorgaben für die Bestätigung ausländischer USt-IdNrn.
Ab Juli 2025 gilt: Bestätigungen ausländischer USt-IdNrn. nur noch online – Das BMF verpflichtet Unternehmen zur ausschließlichen Nutzung der digitalen Abfrage beim BZSt. Die Änderung des Abschnitts 18e.1 UStAE zielt auf mehr Einheitlichkeit und Effizienz im Umsatzsteuerverfahren.
Die neue Ausgabe kostenlos im Kiosk
Werfen Sie einen Blick in die aktuelle Ausgabe und überzeugen Sie sich selbst vom ExpertenReport. Spannende Titelstories, fundierte Analysen und hochwertige Gestaltung – unser Magazin gibt es auch digital im Kiosk.