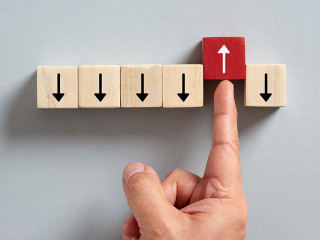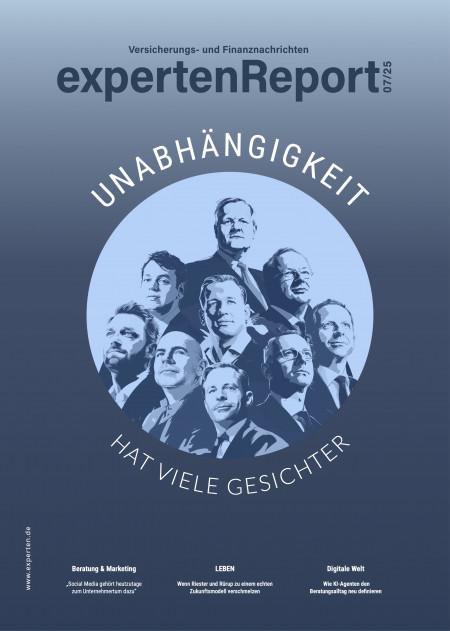Die krisenhafte Zuspitzung auf den Gasmärkten belastet die deutsche Wirtschaft schwer. Die stark gestiegenen Gaspreise erhöhen die Energiekosten drastisch und gehen mit einem massiven gesamtwirtschaftlichen Kaufkraftentzug einher.
Trotz eines Rückgangs in der zweiten Jahreshälfte dürfte das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um 1,4 Prozent ausgeweitet werden. Für das kommende Jahr erwarten die Institute der Gemeinschaftsdiagnose für das Bruttoinlandsprodukt im Jahresdurchschnitt einen Rückgang um 0,4 Prozent, für das Jahr 2024 einen Anstieg um 1,9 Prozent.
Die Institute halbieren damit annähernd ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose für dieses Jahr. Für das kommende Jahr senken sie ihre Prognose von 3,1 Prozent auf ‒0,4 Prozent. In dieser Revision zeigt sich das Ausmaß der . So fällt die Wirtschaftsleistung im laufenden und kommenden Jahr insgesamt um 160 Mrd. Euro niedriger aus, als noch im Frühjahr zu erwarten war.
Die Inflationsrate dürfte sich in den kommenden Monaten weiter erhöhen. Jahresdurchschnittlich ergibt sich für das Jahr 2023 mit 8,8 Prozent eine Teuerungsrate, die nochmals leicht über dem Wert des laufenden Jahres von 8,4 Prozent liegt. Erst im Jahr 2024 wird die 2 Prozent-Marke allmählich wieder erreicht.
Der Grund für die Verschlechterung der konjunkturellen Aussichten sind vor allem die reduzierten Gaslieferungen aus Russland. Mit ihnen ist ein erheblicher Teil des Gasangebots weggefallen und auch das Risiko gestiegen, dass die verbleibenden Liefer- und Speichermengen im Winter nicht ausreichen werden, um die Nachfrage zu decken.
Vor diesem Hintergrund sind die Gaspreise in den Sommermonaten in die Höhe geschossen. Die Unternehmen haben bereits damit begonnen, ihren Gasverbrauch spürbar einzuschränken. Auch wenn die Institute für den kommenden Winter bei normalen Witterungsbedingungen mit keiner Gasmangellage rechnen, bleibt die Versorgungslage äußerst angespannt.
Mittelfristig dürfte sich die Lage zwar etwas entspannen, dennoch dürften die Gaspreise deutlich über Vorkrisenniveau liegen. Dies bedeutet für Deutschland einen permanenten Wohlstandsverlust. Vom Arbeitsmarkt geht eine stabilisierende Wirkung aus. Zwar dürfte die Nachfrage nach neuen Arbeitskräften angesichts der konjunkturellen Schwächephase zurückgehen. Die Unternehmen werden aufgrund des Fachkräftemangels in vielen Bereichen aber bestrebt sein, den vorhandenen Personalbestand zu halten, sodass die Erwerbstätigkeit nur vorübergehend geringfügig sinken dürfte.
Der russische Angriff auf die Ukraine und die daraus resultierende Krise auf den Energiemärkten führen zu einem spürbaren Einbruch der deutschen Wirtschaft, erklärt Torsten Schmidt, Konjunkturchef des RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung und Sprecher der Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose. Er prognostiziert, dass die hohen Energie- und Lebensmittelpreise, die im kommenden Jahr weiter ansteigen dürften, für deutliche Kaufkraftverluste sorgen werden.
Sowohl einkommensschwache Haushalte als auch Unternehmen seien deshalb auf weitere Unterstützung der Politik angewiesen, so Schmidt. Bei den Unternehmen sei allerdings darauf zu achten, dass es nicht zu dauerhaften Subventionen komme. Immerhin zeige sich der Arbeitsmarkt stabil, aufgrund des Personalmangels in vielen Branchen sei trotz der Wirtschaftskrise keine erhöhte Arbeitslosigkeit zu erwarten.
Die Gemeinschaftsdiagnose wird zweimal im Jahr im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz erstellt. Am Herbstgutachten 2022 haben mitgewirkt:
- ifo Institut – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e. V. in Kooperation mit Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO)
- Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW Kiel)
- Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH)
- RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Kooperation mit dem Institut für Höhere Studien Wien
Themen:
LESEN SIE AUCH
Warum die Inflation ein hartnäckiger Gegner ist
Atradius: Trübe Aussichten für 2024
Rezessionswahrscheinlichkeit steigt auf knapp 80 Prozent
Jeder vierte Deutsche hat Probleme finanziell über die Runden zu kommen
Unsere Themen im Überblick
Themenwelt
Wirtschaft
Management
Recht
Finanzen
Assekuranz
Wohlstandsversprechen bröckelt – Klaus Regling fordert historischen Reformkompromiss
Kurzarbeitergeld verlängert: Was die 24-Monats-Regel für Unternehmen und Beschäftigte bedeutet
Aus Bürgergeld wird Grundsicherungsgeld
Wut in der Wirtschaft gegen Merz-Regierung – BDI-Chef warnt vor Systemkrise
Die neue Ausgabe kostenlos im Kiosk
Werfen Sie einen Blick in die aktuelle Ausgabe und überzeugen Sie sich selbst vom ExpertenReport. Spannende Titelstories, fundierte Analysen und hochwertige Gestaltung – unser Magazin gibt es auch digital im Kiosk.