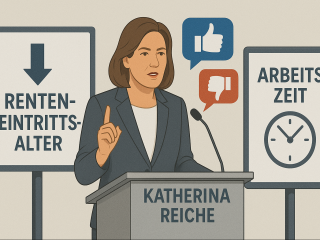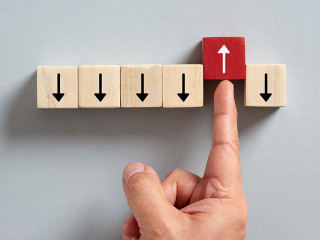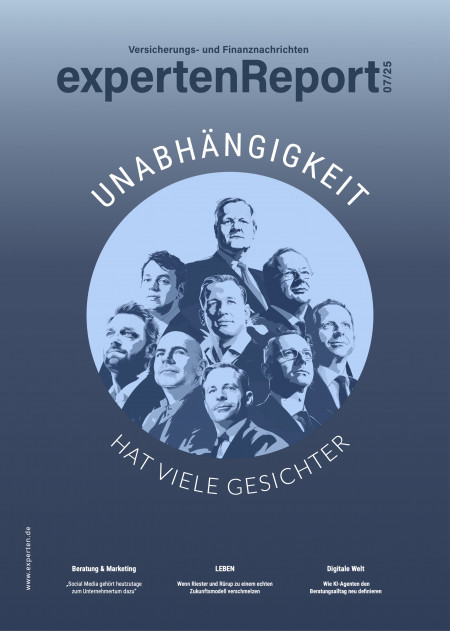Eine mögliche Lösung, wie schrumpfende Erwerbsbevölkerung bekämpft werden kann, ist die Erhöhung der Erwerbsbeteiligung von Frauen und älteren Menschen. Leider hat es sich als äußerst schwierig erwiesen, dies zu erreichen. Daher sind jetzt radikale Ansätze erforderlich.
Ein Kommentar von Lombard Odier Funds
Die Covid-19-Pandemie hat den Fortschritt untergraben, da Schulen aufgrund von Lockdown-Maßnahmen gezwungen waren, zu schließen oder auf Online-Unterricht umzustellen. Es bleibt zu hoffen, dass dieser Effekt nur vorübergehend ist und die Zahl der Erwerbstätigen mit dem Fortschreiten der Impfprogramme wieder steigen werden.
Um jedoch dem Rückgang der Erwerbsbevölkerung entgegenzuwirken, müssen diese Zuwächse den historischen Trend übertreffen. Nachdem die Beschäftigungsquote der Frauen bis 2020 in Europa auf etwa 50 Prozent und in den USA auf 55 Prozent angestiegen war, hat die Pandemie die Quote der Frauen stärker beeinträchtigt als die der Männer und die Verbesserungen von 2018 zunichte gemacht. Dies wird sich hoffentlich im Zuge der Wiederbelebung der Wirtschaft wieder ändern.
Erwerbsquote der Frauen muss steigen
Um den geschätzten jährlichen Rückgang der Erwerbsbevölkerung um 3 Prozent auszugleichen, muss die Erwerbsquote der Frauen um 6 Prozentpunkte steigen. Daher muss sie bis 2030 über 90 Prozent liegen, also höher als die heutige Erwerbsquote der Männer. Bei diesem Szenario wird ein jährlicher Rückgang der geschätzten Erwerbsbevölkerung um 3 Prozent angenommen.
Um den geschätzten jährlichen Rückgang von 5 Prozent zu kompensieren, müsste die Quote von Arbeitnehmerinnen in den nächsten fünf Jahren bei 100 Prozent liegen. Mit anderen Worten: Es stehen einfach nicht genügend Frauen für die Arbeitswelt zur Verfügung, um den Alterungstrend in den westlichen Volkswirtschaften und in China zu kompensieren.
Über 65-Jährige: Erwerbsquote war vor 50 Jahren höher
Die Erhöhung der Erwerbsquote von Menschen im Alter von 65 Jahren oder mehr scheint ein Patentrezept zu sein, das theoretisch sowohl die Abnahme der Erwerbsbevölkerung als auch die Zahl der abhängigen Ruheständler verringern könnte. Auch aus historischer Sicht wäre dies sinnvoll, denn das Rentenalter von 65 Jahren ist seit mehr als einem Jahrhundert in Stein gemeißelt, während sich unsere Lebenserwartung mehr als verdoppelt hat.
In den 1950er bis 1970er Jahren war die Erwerbsquote der über 65-Jährigen in den meisten westlichen Ländern höher als heute. Dies war etwa in den USA, Japan und Deutschland der Fall. Damals war jedoch der Anteil älterer Menschen in der Gesellschaft viel geringer als heute und die Lebenserwartung war niedriger.
Zusammenhang erkennbar
Als die Lebenserwartung stieg und die Rentenleistungen zunahmen, ging die Erwerbsquote älterer Arbeitnehmer von den 1960er bis in die 1980er Jahre stetig zurück. Seit den 1990er Jahren sind wieder mehr ältere Arbeitnehmer erwerbstätig, da die Rentenleistungen gekürzt oder herabgesetzt wurden.
Die Forscher Button sowie Goodhart und Pradhan stellen fest, dass es einen starken, logischen Zusammenhang zwischen der Erwerbsbeteiligung älterer Menschen und dem durch die Rentensysteme garantierten Wohlstand gibt.
Derselbe Effekt ist in der Altersgruppe der 55- bis 64-Jährigen zu beobachten: Als zu Beginn dieses Jahrhunderts in vielen europäischen und nordamerikanischen Ländern die Vorruhestandsregelungen eingestellt oder zurückgefahren wurden, stieg die Erwerbsquote an.
Anhebung des Renteneintrittsalters notwendig
Damit ältere Menschen länger arbeiten können, muss das offizielle Renteneintrittsalter – definiert als das Alter, ab dem man eine staatliche oder private Rente beziehen kann – erhöht werden. Nach den demografischen Statistiken der Vereinten Nationen steigt die Verfügbarkeit von Arbeitskräften für jedes Jahr, in dem Menschen über 65 Jahre arbeiten, um 2 Prozent. Nach diesen Zahlen und angesichts des zu erwartenden jährlichen Rückgangs der Erwerbsbevölkerung um 3 Prozent müssten die Menschen ihren Renteneintritt um 18 Monate hinausschieben.
Oder wenn wir den gesamten Rückgang des Arbeitskräfteangebots von 5 Prozent pro Jahr ausgleichen wollen, muss der Eintritt in den Ruhestand um 2,5 Jahre verschoben werden. Es ist jedoch zu beachten, dass diese Verschiebung des Renteneintritts jedes Jahr erfolgen müsste, was zu einer kumulativen Verlängerung der Lebensarbeitszeit führen würde, so dass die Menschen im Jahr 2030 erst mit 77 oder sogar 85 Jahren in Rente gehen könnten.
Es mag für einen US-Präsidenten möglich sein, bis zu diesem Alter zu arbeiten. Aber ein Politiker, der vorschlägt, das Renteneintrittsalter jedes Jahr um 18 bis 30 Monate zu erhöhen, würde nicht lange im Amt bleiben.
Themen:
LESEN SIE AUCH
Frauen fürchten häufiger Altersarmut als Männer
Debatte um längeres Arbeiten: Wirtschaftsministerin Reiche fordert höhere Lebensarbeitszeit
Gemeinsam für starken Antrieb sorgen.
Debatte um längere Lebensarbeitszeit: Was Arbeitnehmer jetzt tun sollten
Unsere Themen im Überblick
Themenwelt
Wirtschaft
Management
Recht
Finanzen
Assekuranz
Neue Inflationsdaten zeigen: Teuerung trifft nicht alle Haushalte gleich
Wohlstandsversprechen bröckelt – Klaus Regling fordert historischen Reformkompromiss
Kurzarbeitergeld verlängert: Was die 24-Monats-Regel für Unternehmen und Beschäftigte bedeutet
Aus Bürgergeld wird Grundsicherungsgeld
Die neue Ausgabe kostenlos im Kiosk
Werfen Sie einen Blick in die aktuelle Ausgabe und überzeugen Sie sich selbst vom ExpertenReport. Spannende Titelstories, fundierte Analysen und hochwertige Gestaltung – unser Magazin gibt es auch digital im Kiosk.