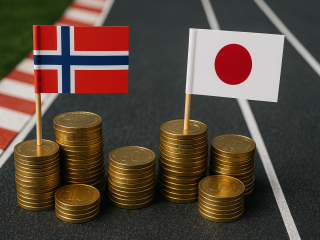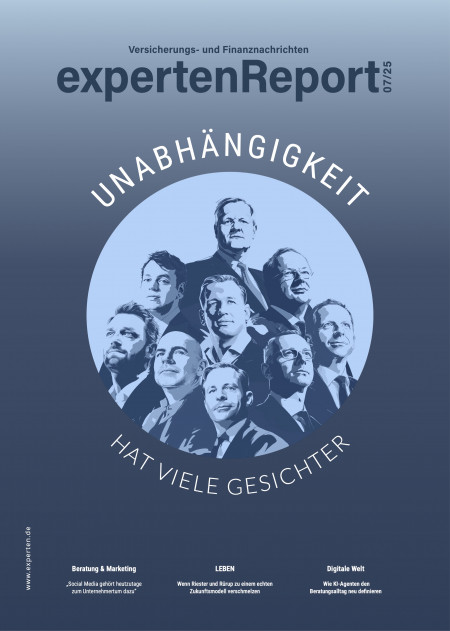Währungen sind ein Indikator für Stabilität und Vertrauen. Sie rücken daher zwangsläufig in den Blickpunkt, wenn es zu ökonomischen Krisen, politischen Konflikten oder technologischen Umbrüchen kommt. Die aktuellen Gefahren für die Währungsstabilität resultieren aus stark steigender Staatsverschuldung, dauerhaft niedrigen Zinsen, drohenden Inflationsprozessen und politisch-institutionellen Abhängigkeiten zwischen Geld- und Fiskalpolitik.
Gleichzeitig bringen technologische Entwicklungen mögliche Alternativen zu klassischen Währungen hervor. Aus dem Zusammenspiel dieser Entwicklungen ergeben sich erhebliche Gefahren für die Währungsstabilität, aber auch Chancen. Welche das sind, beleuchtet die neue Studie „Währungen und Werte“, herausgegeben von derPrivatbank Donner & Reuschelin Zusammenarbeit mit dem Hamburgischen WeltWirtschaftsInstitut.
Grundsätzlich gibt es für die Stabilität einer Währung zwei große Gefahren: Einerseits kann es durch kreditfinanzierte Übertreibungen zu Schuldenkrisen kommen, andererseits können Inflationsprozesse die Geldwertstabilität zerstören. Angesichts der gigantischen Mittel, die der Staat im Zuge der Corona-Pandemie weltweit zur Verfügung stellt, dominiert aktuell die Frage, wo die Grenze der Staatsverschuldung liegt und wie gefährlich diese ist bzw. ob sie nicht gar die Stabilität von Währungen bedroht?
Abhängigkeiten zwischen Geld- und Fiskalpolitik
Auch wenn es heute kurzfristig gute Gründe für die hohen Schulden und die niedrigen Zinsen gibt, erzeugen sie zukünftige Abhängigkeiten zwischen Geld- und Fiskalpolitik, die sich im Laufe der Zeit verschärfen und Wachstumspotenziale senken können. Wenn im Zuge einer voranschreitenden De-Globalisierung das Güterangebot unelastischer wird, könnte die hohe Liquiditätszufuhr zu einem Nachfrageüberhang führen und letztlich die Inflation zurückbringen.
Das wiederum müsste die Zentralbanken dazu anhalten, die Zinsen zu erhöhen, was die Tragfähigkeit der Staatsschulden und die Stabilität der Kapitalmärkte in Mitleidenschaft ziehen würde. Ohne koordinierte und stabilitätsorientierte Fiskalpolitik auf zentralisierter Ebene wird die Geldpolitik immer wieder Krisenmanagement vornehmen und ihr geldpolitisches Mandat ausweiten müssen. Dies wiederum zeigt, dass die Währungsstabilität nicht nur eine Sache von technischer Geldpolitik, sondern eine höchst politische Angelegenheit ist.
Währungen als Gradmesser einer Gesellschaft
Dem Anliegen dieser Studienreihe entsprechend ergeben sich daraus Verantwortungen und Handlungsfelder für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Es gilt also, gemeinsam Vertrauen, Stabilität und Glaubwürdigkeit zu stärken, um die Voraussetzung dafür zu schaffen, den Wandel auf politisch, ökonomisch und gesellschaftlich stabiler Grundlage zu bewältigen. Da Währungen das Maß an Vertrauen in die Zukunft und die Glaubwürdigkeit der Institutionen abbilden, sind sie ein guter Gradmesser dafür, wie stark die Grundlagen einer Gesellschaft sind.
Auch für Anleger werden die Zeiten somit nicht einfacher. Einerseits drohen weitere jahrlange Null- und Negativzinsen bei gleichzeitig steigenden Inflationsperspektiven, mit der Folge eines schleichenden Verlusts an realer Kaufkraft. Andererseits bringen strukturelle Veränderungen laufend steigende Herausforderungen für alle Formen von Kapitalanlagen und klassische Währungen mit sich. Nicht zuletzt stellt sich die Frage, ob digitale und Kryptowährungen künftig Alternativen darstellen werden.
Carsten Mumm, Co-Autor der Studie und Chefvolkswirt bei der Privatbank Donner & Reuschel, fasst zusammen: „International wird der US-Dollar etwas von seiner Stärke einbüßen, während der Euro dazugewinnen wird. Inwieweit sich der chinesische Yuan als internationale Reservewährung etablieren kann, hängt stark davon ab, ob China sich wirtschaftlich und währungspolitisch weiter öffnet. Kryptowährungen können hingegen nicht dem klassischen Währungssegment zugeordnet werden, bleiben aber in Zeiten struktureller Nullzinsen und explodierender Staatsschulden gefragt“.
Themen:
LESEN SIE AUCH
Das große Geld glaubt weiter an Kryptowährungen
DIVA-Institut untersucht Inflationsängste
Deutscher Geldanlage-Index Sommer 2024: Wenig Aufregung in unruhigem Markt
Assetklassenvergleich: Retail-Investments schneiden am besten ab
Unsere Themen im Überblick
Themenwelt
Wirtschaft
Management
Recht
Finanzen
Assekuranz
Globale Asset Owner im Umbruch: Norwegens Staatsfonds überholt Japans
Anleihen kontra Aktien? Warum die Risikoprämie kippt
„Wir sind weit entfernt von einer KI-Blase“
Finanzielle Freiheit: Generation Z zwischen Ideal und Realität
Die neue Ausgabe kostenlos im Kiosk
Werfen Sie einen Blick in die aktuelle Ausgabe und überzeugen Sie sich selbst vom ExpertenReport. Spannende Titelstories, fundierte Analysen und hochwertige Gestaltung – unser Magazin gibt es auch digital im Kiosk.