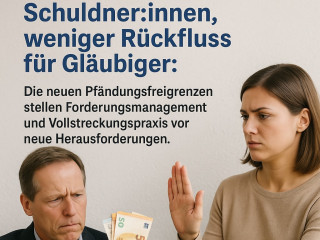Photo credit: depositphotos.com
Das Finanzierungsdefizit des Staates lag nach vorläufigen Berechnungen im 1. Halbjahr 2024 bei 38,1 Milliarden Euro. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, war das staatliche Defizit somit um 1,3 Milliarden Euro niedriger als im 1. Halbjahr 2023. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) in jeweiligen Preisen errechnet sich für das 1. Halbjahr 2024 eine Defizitquote von 1,8 Prozent.
Bei den Ergebnissen handelt es sich um Daten in der Abgrenzung des Europäischen Systems Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG) 2010. Sie bilden die Grundlage für die Überwachung der Haushaltslage in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) nach dem Stabilitäts- und Wachstumspakt (Maastricht-Kriterien) und sind nicht identisch mit dem Finanzierungssaldo des Öffentlichen Gesamthaushalts in Abgrenzung der Finanzstatistiken. Aus den Ergebnissen für das 1. Halbjahr lassen sich nur begrenzt Rückschlüsse auf das Jahresergebnis ziehen.
Bund verzeichnet Finanzierungsdefizit von 24,6 Milliarden Euro
Mit 24,6 Milliarden Euro hatte der Bund im 1. Halbjahr 2024 wie bereits im Vorjahreszeitraum den größten Anteil am gesamtstaatlichen Finanzierungsdefizit. Allerdings reduzierte sich das Finanzierungsdefizit des Bundes deutlich um 17,9 Milliarden Euro. Dagegen erhöhten sich die Finanzierungsdefizite von Ländern und Gemeinden. Im 1. Halbjahr 2024 betrug das Finanzierungsdefizit der Länder 7,2 Milliarden Euro (1. Halbjahr 2023: 4,0 Milliarden Euro) und das Finanzierungsdefizit der Gemeinden 6,4 Milliarden Euro (1. Halbjahr 2023: 2,5 Milliarden Euro). Die Sozialversicherung verzeichnete im 1. Halbjahr 2024 einen Finanzierungsüberschuss von 0,2 Milliarden Euro, deutlich niedriger als noch im 1. Halbjahr 2023 (9,6 Milliarden Euro).
Staatliche Einnahmen steigen stärker als Ausgaben
Das Finanzierungsdefizit des Staates im 1. Halbjahr 2024 ergibt sich aus der Differenz zwischen Einnahmen in Höhe von 973,5 Milliarden Euro und Ausgaben in Höhe von 1 011,6 Milliarden Euro. Die Einnahmen stiegen im 1. Halbjahr 2024 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,7 Prozent. Der Ausgabenzuwachs war mit 4,4 Prozent etwas niedriger.
Steuereinnahmen und Sozialbeiträge steigen
Die Steuereinnahmen des Staates erhöhten sich im 1. Halbjahr 2024 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum insgesamt um 3,6 Prozent. Bei der Mehrwertsteuer wurde ein Zuwachs von 2,5 Prozent verzeichnet, die Einnahmen aus Einkommensteuern stiegen um 4,1 %. Aufgrund eines weiterhin robusten Arbeitsmarkts, deutlichen Lohnsteigerungen, der Anhebung der Beitragsbemessungsgrenzen und der Erhöhung der Beitragssätze zur gesetzlichen Pflegeversicherung ab Juli 2023 waren die Sozialbeiträge im 1. Halbjahr 2024 um 6,8 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum.
Die Zinseinnahmen des Staates stiegen im 1. Halbjahr 2024 gegenüber dem 1. Halbjahr 2023 um 19,3 Prozent. Höhere Einnahmen aus der LKW-Maut aufgrund des im Dezember 2023 eingeführten CO2-Zuschlags trugen ebenfalls zum Anstieg der Einnahmen des Staates bei.
Auslaufende Energiepreisbremsen dämpfen den Ausgabenanstieg
Die Ende des Jahres 2023 ausgelaufenen Maßnahmen zur Entlastung von hohen Energiepreisen (Energiepreisbremsen) trugen im 1. Halbjahr 2024 wesentlich zu einem Rückgang der Subventionen um 39,8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum bei. Dagegen waren die monetären Sozialleistungen des Staates im 1. Halbjahr 2024 um 6,7 Prozent höher als im 1. Halbjahr 2023.
Die Zinsausgaben des Staates stiegen im 1. Halbjahr 2024 gegenüber dem 1. Halbjahr 2023 um 31,9 Prozent. Auch die Bruttoinvestitionen des Staates erhöhten sich deutlich um 9,8 Prozent.
Methodische Hinweise zur Generalrevision 2024
Im Rahmen der Generalrevision 2024 der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (VGR) wurden die Berechnungen für die Einnahmen und Ausgaben des Staates grundlegend überprüft und teilweise überarbeitet. Um Brüche in den Zeitreihen zu vermeiden, wurden die Ergebnisse für Deutschland zurück bis 1991 revidiert, sodass es in Teilen zu geänderten Ergebnissen in den gesamten Zeitreihen ab 1991 kommt.
Umlagen zur Förderung erneuerbarer Energien werden nun in den VGR nicht mehr den Strompreisen zugerechnet, sondern als staatliche Subventionierung der Produktion erneuerbarer Energien durch den Bund dargestellt. Auf der Einnahmenseite des Bundes werden die Umlagen als Gütersteuern gebucht, auf der Ausgabenseite stellen die Zahlungen an die Stromproduzenten sonstige Subventionen dar. Unternehmen des öffentlichen Personennahverkehrs sowie die Infrastrukturunternehmen der Deutschen Bahn wurden aufgrund neuer methodischer Vorgaben durch das Statistische Amt der Europäischen Union (Eurostat) rückwirkend dem Staatssektor zugeordnet.
Weitere methodische Hinweise: Abweichungen zwischen dem Finanzierungssaldo des Staates in Abgrenzung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen und dem Finanzierungssaldo des Öffentlichen Gesamthaushalts in Abgrenzung der Finanzstatistiken sind in methodischen Unterschieden begründet. Detaillierte Informationen hierzu bietet die Seite „Defizitberechnung“ im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes.
Themen:
LESEN SIE AUCH
Vorschau EZB-Sitzung: Erster Zinsschritt nach unten wahrscheinlich
Die sich stabilisierende Inflation im Euroraum dürfte die Europäische Zentralbank (EZB) bei der Sitzung am 6. Juni zu einer ersten Zinssenkung um 25 Basispunkte veranlassen und eine Zinswende besiegeln. Bauzinsen sollten sich längerfristig bei etwa 3,0 bis 3,5 Prozent einpendeln.
Leitzinssätze der EZB bleiben unverändert
Der EZB-Rat hat heute beschlossen, die drei Leitzinssätze der EZB unverändert zu belassen: Der Zinssatz für die Hauptrefinanzierungsgeschäfte sowie die Zinssätze für die Spitzenrefinanzierungsfazilität und die Einlagefazilität bleiben bei 4,50 Prozent, 4,75 Prozent beziehungsweise 4,00 Prozent.
Finanzielle Unterstützung optimieren: Neuerungen in der Förderlandschaft
Um den Nutzen der KfW-Förderprogramme zu veranschaulichen, lohnt sich ein Blick auf konkrete Fallbeispiele. Sie zeigen, wie vielfältig Fördermittel sind und welchen Beitrag sie für nachhaltige und zukunftsorientierte Projekte leisten können.
Leitzinssätze im Euroraum bleiben unverändert
Der EZB-Rat hat beschlossen, die Leitzinssätze zum vierten Mal in Folge unverändert zu belassen, trotz der rückläufigen Inflation und einer schwächelnden Konjunktur im Euroraum.
Unsere Themen im Überblick
Themenwelt
Wirtschaft
Management
Recht
Finanzen
Assekuranz
Zwischen Zauber und Zahlen: Warum deutsche Aktien wieder Chancen bieten
Trotz Konjunktursorgen, geopolitischer Spannungen und struktureller Probleme sehen viele Anleger wieder Potenzial im deutschen Aktienmarkt. Portfoliomanager Olgerd Eichler von MainFirst nennt sechs gute Gründe – mit überraschend positiven Langfristaussichten.
Höhere Pfändungsfreigrenzen ab 1. Juli 2025: Was das für Gläubiger bedeutet
Zum 1. Juli 2025 steigen die Pfändungsfreigrenzen – für Schuldner:innen bedeutet das mehr finanzieller Spielraum, für Gläubiger hingegen weniger pfändbare Beträge und längere Rückzahlungszeiträume. Was das konkret heißt und worauf Gläubiger jetzt achten müssen.
In der Steuerung des Kreditrisikos liegt ein strategischer Hebel
Protektionismus, Handelskonflikte, geopolitische Risiken – die Unsicherheit an den Märkten bleibt hoch. Passive Kreditstrategien stoßen in diesem Umfeld schnell an ihre Grenzen. Warum gerade aktives Management und ein gezielter Umgang mit Kreditaufschlägen den Unterschied machen können, erklärt Jörg Held, Head of Portfolio Management bei Ethenea.
Mehrheit befürwortet Rüstungsinvestments – Akzeptanz steigt auch bei nachhaltigen Fonds
Private Geldanlagen in Rüstungsunternehmen polarisieren – doch laut aktueller Verivox-Umfrage kippt die Stimmung: 56 Prozent der Deutschen halten solche Investments inzwischen für legitim. Auch nachhaltige Fonds greifen vermehrt zu.
Die neue Ausgabe kostenlos im Kiosk
Werfen Sie einen Blick in die aktuelle Ausgabe und überzeugen Sie sich selbst vom ExpertenReport. Spannende Titelstories, fundierte Analysen und hochwertige Gestaltung – unser Magazin gibt es auch digital im Kiosk.