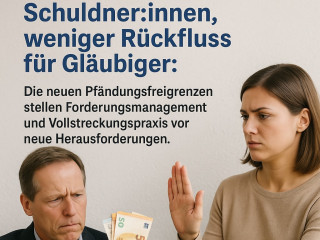Ein neues Auto zu erwerben, ist eine wichtige finanzielle Entscheidung, die sorgfältig abgewogen werden sollte. Neben allgemeinen Budgetfragen ist die Wahl der Finanzierungsmethode ein zentraler Aspekt dieser Entscheidung. Infrage kommen vor allem Privatkredit und Leasing als beliebte Optionen. Dieser Artikel bietet einen umfassenden Vergleich beider Finanzierungswege, um bei der Entscheidungsfindung zu unterstützen.
Wem gehört das Auto?
Bevor wir in die Unterschiede zwischen Privatkredit und Leasing eintauchen, betrachten wir zunächst die Grundlagen. Das Eigentumsverhältnis ist hier einer der entscheidenden Unterschiede: Bei einem Privatkredit wird der Käufer sofortiger Eigentümer des Fahrzeugs, während beim Leasing das Auto im Eigentum der Leasinggesellschaft bleibt.
Dieser Unterschied ist nicht nur auf dem Papier wichtig, sondern hat auch Auswirkungen auf die Art und Weise, wie das Fahrzeug genutzt werden darf. So kann der Leasinggeber umfassende und strenge Vorgaben machen, die mit Einschränkungen und Mehrkosten verbunden sein können. Im Leasingvertrag wird beispielsweise bestimmt, wie viele Kilometer das Auto im Jahr zurücklegen darf, ohne dass es zu höheren Kosten kommt.
Kosten
In puncto Kosten ist die Entscheidung oft nicht eindeutig: Einfach einen Kredit aufnehmen, ist zunächst mit höheren monatlichen Raten verbunden, führt jedoch in der Regel langfristig zu niedrigeren Gesamtkosten. Leasing hingegen besticht vor allem durch niedrigere monatliche Raten, die sich allerdings potenziell zu höheren Gesamtkosten addieren.
Insbesondere, wenn man sich entscheidet, das Auto nach Ablauf des Leasingvertrags zu übernehmen, ist die Kreditfinanzierung häufig die günstigere Variante, den normalen Kosten, fallen beim Leasing eventuell auch Rückgabe- oder Kaufgebühren am Vertragsende an. In der Regel ist außerdem über die gesamte Dauer des Leasingvertrags eine Vollkaskoversicherung Pflicht.
Beim Privatkredit hingegen sind die Zinszahlungen steuerlich abzugsfähig und es kann bei Reparatur- und Wartungskosten gespart werden, da die Werkstattbindung entfällt. Da der Wagen Eigentum des Käufers ist, kann dieser zudem frei über den Weiterverkauf entscheiden und Versicherungsoptionen an die individuellen Präferenzen und den Fahrzeugwert anpassen. Die sorgfältige Analyse sowohl der Gesamtkosten als auch der monatlichen Belastungen ist daher entscheidend, um die richtige Finanzierungsoption zu wählen.
Flexibilität in der Ausstattung
Die Flexibilität der beiden Modelle sollte ebenfalls bei der Entscheidung in Betracht gezogen werden. Privatkredite bieten mehr Freiheit bezüglich der Fahrzeugausstattung, Kilometer-Limits und mehr, während Leasingverträge oft strenge Vorgaben bezüglich der Fahrzeugnutzung machen. Die Auswahl eines bestimmten Automodells mit Wunschausstattung kann bei Leasingangeboten ebenfalls eingeschränkt oder mit Mehrkosten verbunden sein, während bei der Kreditfinanzierung die gesamte Palette verfügbar ist.
Dauer der Nutzung
Leasingnehmer stehen nach einigen Jahren der Nutzung vor der Entscheidung, ob sie den Wagen zurückgeben oder weiternutzen möchten. Dabei wird der Restwert bei Vertragsende zu Beginn verbindlich festgelegt. Nach Ablauf eines Leasingvertrags kann das Auto zu diesem Preis erworben werden oder man entscheidet sich für die Rückgabe an den Leasinggeber.
Die meisten Leasingnehmer empfinden diese Option als nachteilig und entscheiden sich stattdessen für den Abschluss eines neuen Leasingvertrags. Beim Kreditkauf kann der Käufer frei entscheiden, wie und wie lange er das Auto nutzen möchte und zu welchem Preis er es gegebenenfalls weiterverkaufen möchte.
Der Ablauf im Einzelnen
Der Autokauf mit Privatkredit gestaltet sich durch die einfache Abwicklung als attraktiv. Ein Kredit in gewünschter Höhe wird aufgenommen und monatlich zurückgezahlt. Falls gewünscht, kann das Auto auch als Sicherheit beim Kreditgeber angegeben werden, um dadurch die Zinskosten zu senken. Der Käufer wird auch hier sofortiger Eigentümer des Fahrzeugs, wodurch volle Verfügungsgewalt auf ihn übergeht. Der Prozess umfasst die Kreditprüfung, den Angebotsvergleich und schließlich den Erwerb des Wunschfahrzeugs.
Leasing als Alternative unterscheidet sich in der Vorgehensweise. Monatliche Leasingraten werden für die Nutzungsrechte des Fahrzeugs gezahlt, ohne dass es in den Eigentum des Leasingnehmers übergeht. Der Leasingvertrag legt Bedingungen, wie Serviceanforderungen und Kilometerbeschränkungen, fest, an die sich der Leasingnehmer halten muss. Am Ende der Laufzeit stehen in der Regel die Optionen Kauf, Verlängerung des Mietkaufs oder die Rückgabe des Fahrzeugs zur Verfügung.
Die Vor- und Nachteile im Überblick
Als Vorteile des Leasings gelten die im Vergleich zum Fahrzeugwert niedrigen monatlichen Raten, der regelmäßige Fahrzeugwechsel nach beispielsweise 6 Jahren und der geringe Eigenkapitalbedarf. Nachteile umfassen das fehlende Eigentum am Fahrzeug, Beschränkungen und Gebühren, sowie eventuelle Strafen bei vorzeitigem Vertragsende.
Privatkredite hingegen bieten unmittelbares Eigentum, keine Kilometer- oder Service-Vorgaben, steuerliche Absetzbarkeit und langfristige Kosteneinsparungen. Nachteilig sind vor allem die relativ hohen monatlichen Raten sowie die Abhängigkeit von einer guten Bonität als Voraussetzung für einen günstigen Kredit.
Themen:
LESEN SIE AUCH
Umsatzfinanzierung ist auch in der Krise gefragt
Die Energiekrise und der Ukraine-Krieg setzen den deutschen Mittelstand weiter unter Druck: Finanziell wird die Situation in vielen Betrieben angespannter. So gewinnt der Verkauf offener Forderungen als Mitter zur Umsatzfinanzierung zunehmend an Bedeutung.
Autokredite in München am höchsten
Privater Immobilienerwerb zunehmend schwieriger
Nachhaltiger Ratenkredit für Privatkunden
Unsere Themen im Überblick
Themenwelt
Wirtschaft
Management
Recht
Finanzen
Assekuranz
Zwischen Zauber und Zahlen: Warum deutsche Aktien wieder Chancen bieten
Trotz Konjunktursorgen, geopolitischer Spannungen und struktureller Probleme sehen viele Anleger wieder Potenzial im deutschen Aktienmarkt. Portfoliomanager Olgerd Eichler von MainFirst nennt sechs gute Gründe – mit überraschend positiven Langfristaussichten.
Höhere Pfändungsfreigrenzen ab 1. Juli 2025: Was das für Gläubiger bedeutet
Zum 1. Juli 2025 steigen die Pfändungsfreigrenzen – für Schuldner:innen bedeutet das mehr finanzieller Spielraum, für Gläubiger hingegen weniger pfändbare Beträge und längere Rückzahlungszeiträume. Was das konkret heißt und worauf Gläubiger jetzt achten müssen.
In der Steuerung des Kreditrisikos liegt ein strategischer Hebel
Protektionismus, Handelskonflikte, geopolitische Risiken – die Unsicherheit an den Märkten bleibt hoch. Passive Kreditstrategien stoßen in diesem Umfeld schnell an ihre Grenzen. Warum gerade aktives Management und ein gezielter Umgang mit Kreditaufschlägen den Unterschied machen können, erklärt Jörg Held, Head of Portfolio Management bei Ethenea.
Mehrheit befürwortet Rüstungsinvestments – Akzeptanz steigt auch bei nachhaltigen Fonds
Private Geldanlagen in Rüstungsunternehmen polarisieren – doch laut aktueller Verivox-Umfrage kippt die Stimmung: 56 Prozent der Deutschen halten solche Investments inzwischen für legitim. Auch nachhaltige Fonds greifen vermehrt zu.
Die neue Ausgabe kostenlos im Kiosk
Werfen Sie einen Blick in die aktuelle Ausgabe und überzeugen Sie sich selbst vom ExpertenReport. Spannende Titelstories, fundierte Analysen und hochwertige Gestaltung – unser Magazin gibt es auch digital im Kiosk.