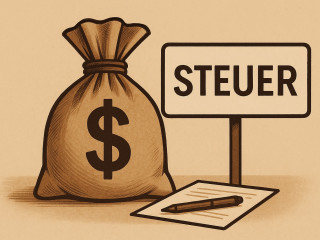Globale Mergers and Acquisitions (M&A) outperformten in den ersten drei Monaten des Jahres 2023 den Gesamtmarkt zum dritten Mal in Folge. Das zeigt die Studie „Quarterly Deal Performance Monitor“ (QDPM) von WTW. Basierend auf der Aktienkursentwicklung übertrafen Unternehmen, die M&A-Deals tätigten, den breiteren Markt um +1,0 PP (Prozentpunkte) für Akquisitionen im Wert von über 100 Millionen US-Dollar zwischen Januar und März 2023. Dies folgt einer positiven Performance von +5,2 PP im Vorquartal.
Die in Zusammenarbeit mit dem M&A Research Center der Bayes Business School erhobenen Daten zeigen, dass die leicht positive Performance des ersten Quartals 2023 von der Transaktionsaktivität im asiatisch-pazifischen Raum angetrieben wurde. Dort übertrafen die Käufer ihren regionalen Index um +13,8 PP. Mit 43 abgeschlossenen Deals im ersten Quartal 2023 verzeichnete die Region einen Volumenrückgang von sieben Prozent im Vergleich zum ersten Quartal 2022.
Weniger M&A-Deals weltweit
Die M&A-Aktivität weltweit verlangsamte sich deutlich und verzeichnete mit 150 abgeschlossenen Deals im ersten Quartal 2023 den niedrigsten Wert für den vergleichbaren Zeitraum seit 2010. Im entsprechenden Quartal 2022 waren es noch 220 Deals.
Martin Theo Carbon, M&A Koordinator Deutschland bei WTW, sagt: „Nach einem wirklich außergewöhnlichem Jahr 2021 und dem folgenden sehr starken Jahr 2022 ist es verständlich, dass die Anzahl der Deals wieder abnimmt." Teilweise kommen die Unternehmen bei den Integrationen nicht nach und wollen zunächst wieder etwas Stabilität etablieren, erklärt Carbon. Weiterhin gebe es zahlreiche makroökonomische und geopolitische Herausforderungen, die bei den Unternehmen die Risikofreude deutlich reduziere.
Deals in Europa haben sich halbiert
In Nordamerika wurden lediglich 77 Deals gezählt. Das ist ein deutlicher Rückgang gegenüber den 116 Deals, die noch im ersten Quartal 2022 verzeichnet wurden. Außerdem war die Performance mit -3,9 Prozentpunkten erneut negativ. In den letzten zwei Quartalen lag diese mit 4,5 Prozentpunkten und 9,4 Prozentpunkten noch deutlich im positiven Bereich.
In Europa hat sich die Zahl der Deals nahezu halbiert. Im Vergleich zu den 49 gezählten Deals im ersten Quartal 2022 waren es für den gleichen Zeitraum in 2023 nur 29 abgeschlossene Transaktionen. Die Performance in Europa bleibt auch im fünften Quartal in Folge negativ und liegt bei -7,4 Prozentpunkten .
Der Raum Asia-Pacific folgt jedoch anderen Regeln. Die Anzahl der Deals veränderte sich kaum. Im Vergleich der letzten vier ersten Quartale der Jahre 2020 bis 2023 liegt die Anzahl der Deals zwischen 41 und 46. Die Performance zeigt konstant positive Zahlen seit sieben Quartalen. Sibylle Kampschulte, WTW-Leiterin M&A in der DACH-Region, erläutert:
In Europa ist der Einfluss der wirtschaftlichen Unsicherheit auf Deal-Entscheidungen sehr deutlich zu sehen und führt häufig zu einer eher abwartenden Haltung beim Abschluss von potentiellen Transaktionen.
Anzahl der branchenübergreifenden Deals hat zugenommen
Die Notwendigkeit, neue Technologien zu nutzen und daher auch neue Talente zu rekrutieren, sowie Lieferketten neu zu erfinden, um die Widerstandsfähigkeit zu erhöhen, hat zu mehr branchenübergreifenden Deals geführt. Sie erreicht mit 43 Prozent aller Transaktionen ihren höchsten Stand seit Beginn der M&A-Studie im Jahr 2008.
Die WTW-Daten zeigen auch, dass der prozentuale Anteil der Deals mit mehr als 70 Tagen Durchlaufzeit weiter gestiegen ist. 71 Prozent aller Deals benötigen mindestens 70 Tage bis zum Abschluss. Das ist der höchste bislang gemessene Wert.
„Wenn man bedenkt, dass sogenannte „Quick Deals“ in der Vergangenheit statistisch erfolgreicher waren, ist das keine gute Entwicklung“, gibt Carbon zu bedenken. „Wenn sich allerdings auch die Art der Deals hin zu branchenübergreifenden Aktivitäten verändert und man die gleichen Prozesse nutzt, liegt es auf der Hand, dass die Deals mehr Zeit in Anspruch nehmen.“
Kampschulte ergänzt: „Tatsächlich ist die Anzahl der Deals, die wir in der Pipeline sehen, nicht gesunken. Aber viele brauchen länger bis zum Abschluss oder haben pausiert, da die Käufer den Markt kritischer beobachten und abwarten. Gleichzeitig sehen wir, dass viele kleine Akquisitionen getätigt werden."
Die weitere Professionalisierung der M&A Aktivitäten sollte daher im Zentrum des Interesses der Unternehmen stehen. Für Käufer, die in dem derzeit unsicheren Wirtschaftsklima Transaktionen anstreben, wird es wichtiger denn je sein, eine disziplinierte Due Diligence durchzuführen. Zudem sollten sie sich eingehender mit potenziellen Schwächen sowie den besonderen Herausforderungen der künftigen Integration eines Ziels befassen.
„Das Halten und Integrieren neuer Mitarbeitenden nach Abschluss eines Deals ist ebenfalls entscheidend für die Wertsteigerung der Akquisition", rät Kampschulte. Insbesondere dann, wenn qualifizierte Mitarbeiter im Rahmen von sogenannten AcquiHires der eigentliche Business Case hinter der Akquisition waren. In der Folge sollten gut gestaltete Bindungsanreize höchste Priorität für Unternehmen haben, die über den rein monetären Ansatz hinausgehen.
QDPM-Methodik
- Alle Analysen werden aus der Perspektive des Erwerbers durchgeführt.
- Die Aktienkursentwicklung innerhalb der vierteljährlichen Studie wird als prozentuale Veränderung des Aktienkurses von sechs Monaten vor dem Ankündigungsdatum bis zum Ende des Quartals gemessen.
- Alle Transaktionen, bei denen der Erwerber nach der Übernahme weniger als 50 Prozent der Aktien des Zielunternehmens besaß, wurden entfernt. Daher wurden keine Minderheitskäufe in Betracht gezogen. Alle Transaktionen, bei denen der Erwerber vor der Übernahme mehr als 50 Prozent der Zielaktien hielt, wurden ebenfalls entfernt. Daher wurden keine verbleibenden Käufe berücksichtigt.
- Nur abgeschlossene M&A-Transaktionen mit einem Wert von mindestens 100 Millionen US-Dollar, die die Studienkriterien erfüllen, werden in diese Untersuchung aufgenommen.
- Geschäftsdaten stammen von Refinitiv
Themen:
LESEN SIE AUCH
Export unter Druck: Unternehmen sehen geopolitische Risiken als Top-Bedrohung
Die Mehrheit der Unternehmen weltweit rechnet 2025 mit finanziellen Verlusten durch geopolitische Entwicklungen – ausgelöst unter anderem durch Zölle, Sanktionen oder Cyberattacken. Das zeigt der neue „Political Risk Survey“ von Willis (WTW) und Oxford Analytica.
Trumps Zolloffensive: Protektionismus auf Kosten der Weltwirtschaft
US-Präsident Trump führt drastische Zölle gegen China und weitere Handelspartner ein – mit gravierenden Folgen für globale Märkte. Ökonomen warnen vor Preisschocks, Lieferkettenstörungen und einer möglichen Rezession. Eine Analyse der ökonomischen Risiken und politischen Motive.
Unternehmensakquise als einzige Überlebensstrategie
Transformationsprozesse führen zwar zu einem hohen Aufwand mit tiefgreifenden Veränderungen, sind jedoch essenziell, damit Unternehmen zukunftsfähig bleiben. In der aktuellen Situation sind Unternehmenskäufe nicht nur eine Option, sondern oft die einzige Überlebensstrategie für Unternehmen.
Coface aktualisiert Einschätzung der Länderrisiken
Die globale Wirtschaft kommt auch Ende 2023 nicht zur Ruhe: Soziale und politische Risiken nehmen weiter zu und die Finanzstabilität vieler Volkswirtschaften bleibt belastet. Coface versieht daher fünf Länder mit einem schlechteren Länderrisiko. Unter ihnen Finnland, Schweden und Neuseeland.
Unsere Themen im Überblick
Themenwelt
Wirtschaft
Management
Recht
Finanzen
Assekuranz
Fiskalische Zeitenwende oder riskante Halse? Deutschlands Investitions- und Verteidigungskurs im Stresstest
Deutschland steht vor einem wirtschafts- und sicherheitspolitischen Kraftakt historischen Ausmaßes. Mit einem 500-Milliarden-Euro-Investitionspaket und dem Ziel, die Verteidigungsausgaben auf 3,5 % des BIP zu steigern, wagt die Bundesregierung eine fiskalische Zeitenwende. Doch der Spagat zwischen Wachstumsimpulsen, geopolitischer Abschreckung und haushaltspolitischer Stabilität ist riskant – ökonomisch wie gesellschaftlich.
Stromsteuer-Senkung bleibt aus: Verbraucher außen vor
Die Bundesregierung verabschiedet sich von ihrem Versprechen, die Stromsteuer für alle Verbraucher auf das EU-Mindestmaß zu senken. Nur Industrie und Landwirtschaft sollen entlastet werden. Während Ministerin Reiche von „finanzieller Wirklichkeit“ spricht, wirft der Steuerzahlerbund der Regierung einen Wortbruch vor. Die Entscheidung trifft besonders Mittelstand und Haushalte – und beschädigt die politische Glaubwürdigkeit der Ampel.
Ertragsteuern im Rückwärtsgang – aber Lohn- und Umsatzsteuer stabilisieren die Einnahmelage
Wie das Bundesfinanzministerium im Monatsbericht Juni 2025 mitteilt, hat sich das Steueraufkommen im Mai weiter positiv entwickelt – mit einer wichtigen Ausnahme: Die Ertragsteuern geraten spürbar unter Druck. Während Lohn- und Umsatzsteuer verlässlich tragen, wirft der Rückgang bei den ertragsbezogenen Einnahmen Fragen nach der konjunkturellen Substanz auf.
Krisenzeiten hinterlassen Spuren: Finanzielle Engpässe vor allem bei älteren Verbrauchergruppen
Trotz wirtschaftlicher Erholung nach der Corona-Pandemie und dem Beginn des Ukraine-Kriegs bleibt die finanzielle Lage vieler Haushalte angespannt. Welche Verbraucher-Gruppen besonders betroffen sind.
Die neue Ausgabe kostenlos im Kiosk
Werfen Sie einen Blick in die aktuelle Ausgabe und überzeugen Sie sich selbst vom ExpertenReport. Spannende Titelstories, fundierte Analysen und hochwertige Gestaltung – unser Magazin gibt es auch digital im Kiosk.