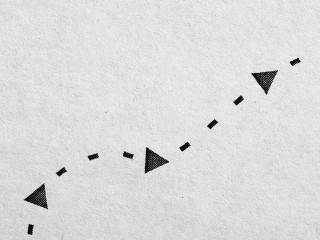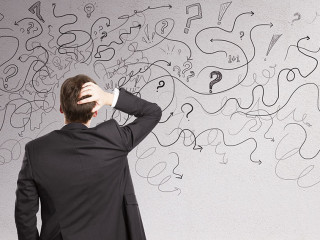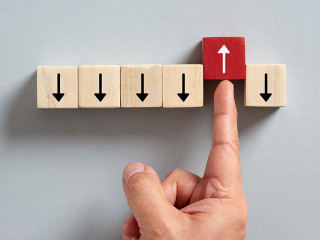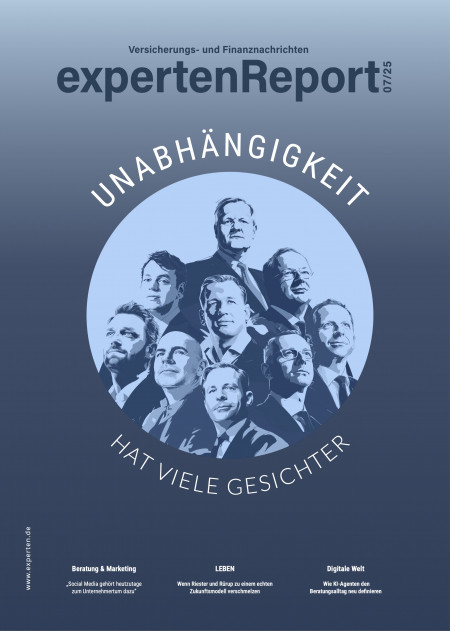Abiturientinnen gehen davon aus, dass sie mit 35 Jahren in einem Vollzeitjob mit Hochschulstudium fast 16 Prozent weniger Gehalt haben werden als Männer. Die Politik ist gefordert, unter anderem Anreize für eine gleichmäßigere Aufteilung der Sorgearbeit zu schaffen, um Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsarbeit weiter zu verbessern.
Bereits kurz nach dem Abitur erwarten Frauen, dass sie im Alter von 35 Jahren in einem Vollzeitjob mit Hochschulabschluss ein um 15,7 Prozent niedrigeres monatliches Nettoeinkommen haben werden als Männer. Das ist das zentrale Ergebnis einer aktuellen Studie, die auf Daten des Berliner-Studienberechtigten-Panels (Best Up) basiert und an der auch das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) beteiligt ist.
Für Tätigkeiten, die eine Berufsausbildung voraussetzen, ist der Gender Gap in den Einkommenserwartungen mit 13 Prozent demnach etwas geringer. Fast die Hälfte der Unterschiede bei den Einkommenserwartungen von Frauen und Männern geht darauf zurück, dass Frauen aufgrund erwarteter familiärer Verpflichtungen mit weniger Einkommen rechnen. Obwohl sich Männer gleichermaßen ausreichend Zeit für die Familie wünschen, gehen sie im Gegensatz zu Frauen nicht davon aus, dass sie deshalb später Abstriche bei ihrem Erwerbseinkommen machen müssen.
© DIW Berlin
„Dass Frauen und Männer unterschiedliche Vorstellungen von ihrem späteren Einkommen haben, mag auf den ersten Blick nicht problematisch erscheinen – doch das Gegenteil ist der Fall: Wenn Frauen beispielsweise mit geringen Erwartungen in Gehaltsverhandlungen gehen, bekommen sie womöglich tatsächlich ein niedrigeres Gehalt, erklärt DIW-Ökonom Andreas Leibing aus der Abteilung Bildung und Familie im DIW Berlin. Zudem können Einkommenserwartungen mit darüber entscheiden, ob sich junge Menschen nach dem Abitur überhaupt für ein Studium einschreiben. Über solche Kanäle trage der Gender Gap bei den Einkommenserwartungen zum tatsächlichen Gender Pay Gap bei.
Gemeinsam mit C. Katharina Spieß, Direktorin des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB), und Frauke Peter vom Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) hat Leibing die Angaben von 308 Frauen und 205 Männern aus dem Jahr 2014 ausgewertet. Im Rahmen von Best Up wurden Schülerinnen und Schüler an insgesamt 27 Berliner Schulen befragt.
Ausbau der Kindertagesbetreuung und mehr Frauen in Führungspositionen als Ansatzpunkte
Für das Szenario eines Vollzeitjobs mit Hochschulabschluss erwarten Frauen den Berechnungen zufolge im Durchschnitt ein monatliches Nettogehalt von 3.153 Euro. Männer hingegen rechnen mit durchschnittlich 3.740 Euro. Die Einkommensabschläge, die Frauen aufgrund ihrer Präferenz für Zeit mit der Familie erwarten, sind bei Karrieren mit einem vorausgesetzten Masterabschluss größer als mit einem Bachelorabschluss. „Dies deutet darauf hin, dass Frauen bereits nach dem Abitur davon ausgehen, eine Vollzeitarbeit eher mit einem geringen Stundenumfang ausüben zu können, und damit bestimmte Karrieren für sich von vornherein ausschließen“, vermutet Peter. Männer hingegen erwarten nicht, dass sie solche Kompromisse werden eingehen müssen.
Wenn die Politik den Gender Pay Gap nachhaltig reduzieren wolle, müsse sie also auch die Einkommenserwartungen junger Menschen in den Fokus nehmen, schlussfolgern Leibing, Peter und Spieß. Zum einen sollte in den Schulen rechtzeitig vor dem Abitur darüber informiert werden, wie sich im späteren Arbeitsleben Familien- und Erwerbsarbeit ohne große Einkommensabschläge vereinbaren lassen.
Zum anderen müsste diese Vereinbarkeit aber auch noch deutlich verbessert werden. So sollten Anreize gesetzt werden, damit sich Frauen und Männer die Familienarbeit gleichmäßiger aufteilen, empfiehlt Spieß. Auch der weitere Ausbau der Kindertagesbetreuung, insbesondere im Bereich ganztägiger Angebote, müsse mit Nachdruck verfolgt werden. Zudem seien mehr Frauen in Führungspositionen wichtig – sie könnten ein Vorbild für junge Frauen sein und zeigen, dass Karriere und Familie zusammengehen, ohne Abstriche beim Einkommen machen zu müssen.
Themen:
LESEN SIE AUCH
Gender Pay Gap sinkt fast nur bei Jüngeren
Der Aufschwung kommt (noch) in Trippelschritten
New Work: Was ist neu & was bleibt beim Alten?
Deutsche Wirtschaft findet noch nicht aus dem Tief heraus
Unsere Themen im Überblick
Themenwelt
Wirtschaft
Management
Recht
Finanzen
Assekuranz
Studie warnt vor Verteidigung auf Kredit
Niedrige Erlöse trotz stabiler Produktion – Agrarmärkte 2025/26 unter Druck
Ostdeutschland 35 Jahre nach der Einheit: Annäherung mit strukturellem Abstand
Neue Inflationsdaten zeigen: Teuerung trifft nicht alle Haushalte gleich
Die neue Ausgabe kostenlos im Kiosk
Werfen Sie einen Blick in die aktuelle Ausgabe und überzeugen Sie sich selbst vom ExpertenReport. Spannende Titelstories, fundierte Analysen und hochwertige Gestaltung – unser Magazin gibt es auch digital im Kiosk.