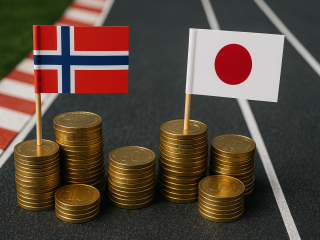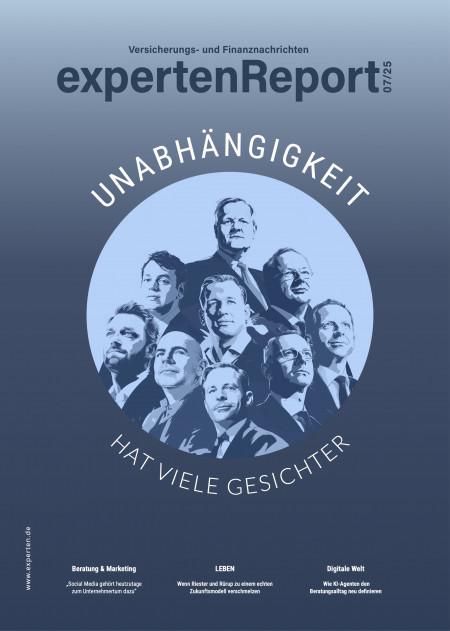Durch Kurzarbeit sind auf dem Höhepunkt der Corona-Krise rechnerisch mehr als sechs Mal so viele Arbeitsplätze gesichert worden wie auf dem Höhepunkt der Finanz- und Wirtschaftskrise 2009.
Laut einer neuen Studie des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung sank im Rahmen der weit verbreiteten Kurzarbeit im zweiten Quartal 2020 die durchschnittliche Zahl der geleisteten Arbeitsstunden pro Beschäftigtem in Deutschland gegenüber dem 4. Quartal 2019 um 17,6 Stunden.
Im entsprechenden Drei-Monatszeitraum 2009 betrug die Reduktion bezogen auf alle Beschäftigten durchschnittlich 3,1 Stunden. Rechnerisch entspricht das knapp 2,2 Millionen gesicherten Jobs auf dem Höhepunkt der Krise 2020 gegenüber rund 330.000 Jobs in der Finanz- und Wirtschaftskrise.
Das spiegelt einerseits den viel größeren Einschlag der aktuellen Krise auf dem Arbeitsmarkt wider, der abgefangen werden musste und weitgehend konnte, so die IMK-Studie. Zum anderen wirken sich weitere Faktoren aus: Anders als in der Finanz- und Wirtschaftskrise spielte etwa der Abbau von Zeitguthaben auf Arbeitszeitkonten diesmal nur eine kleine Rolle, auch weil diese bei Ausbruch der Pandemie deutlich geringer waren.
Hoher Stellenwert von Kurzarbeit in der Pandemie durch erleichterte Zugangsvoraussetzungen
Die gesetzliche Kurzarbeit hat so nach der IMK-Analyse für die Beschäftigungssicherung während der Pandemie einen absolut dominierenden Stellenwert. Die Bundesregierung habe dem Rechnung getragen, indem sie rascher und großzügiger als 2009 die Zugangsvoraussetzungen erleichterte. Auch die gesetzliche Aufstockung des Kurzarbeitergeldes nach mehrmonatigem Bezug stellt laut IMK eine spürbare Verbesserung dar.
Allerdings bleiben deutliche Lücken bei der sozialen Absicherung: So büßten durchschnittliche alleinstehende Kurzarbeitende im April 2020 gut 18 Prozent ihres Einkommens ein, während es im Vergleichszeitraum 2009 knapp 9 Prozent waren. Zudem hatten Beschäftigte mit zuvor schon niedrigen Einkommen anteilsmäßig besonders starke Einbußen.
Hinzu kommt, dass dieses Mal vor allem Dienstleistungsbranchen und damit sehr viele geringfügig Beschäftigte und Soloselbständige betroffen sind, die nicht in die Arbeitslosenversicherung einzahlen und deren Jobs deshalb nicht über Kurzarbeit abgesichert werden können.
In ihrer Untersuchung vergleichen Prof. Dr. Alexander Herzog-Stein, Dr. Ulrike Stein, vom IMK und ihre Ko-Autoren Patrick Nüß und Lennert Peede, Universitäten Kiel und Münster, die schweren Wirtschaftskrisen von 2009 und 2020. In beiden Fällen brach die Beschäftigung weitaus weniger stark ein als die Wirtschaftsleistung, weil es gelang, viele Arbeitsplätze durch zeitweilige drastische Arbeitszeitreduzierung über die Krise zu retten.
Dabei habe sich der Einsatz von Kurzarbeit als Instrument des wirtschaftspolitischen Krisenmanagements gegenüber 2009 weiter verbessert, konstatieren die Forscher.
Die aktuelle Krise offenbare zugleich aber viel stärker strukturelle Probleme des deutschen Arbeitsmarktes, da die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie schwerer sowie langwieriger sind und in weitaus höherem Maße als damals durch Deregulierung schlecht abgesicherte Beschäftigungsformen treffen.
Viel mehr Kurzarbeit, aber auch höhere Beschäftigungsverluste
Unter Ökonomen ist die Finanz- und Wirtschaftskrise zwar als "Große Rezession“ bekannt. Doch im Frühjahrsquartal 2020 brach das Bruttoinlandsprodukt Corona-bedingt noch stärker ein als während der Krise 2008/9. Da die Pandemie zudem beschäftigungsintensive Dienstleistungsbranchen viel heftiger trifft als das Finanzmarktbeben vor einem guten Jahrzehnt, verschärfen sich die Folgen für die Beschäftigung noch einmal, zeigt die IMK-Studie: Vor allem in der ersten Phase verloren deutlich mehr Menschen ihre Arbeit.
Gleichzeitig wurde weitaus mehr Kurzarbeit eingesetzt, um Schlimmeres zu verhindern. Während es auf dem Höhepunkt der Finanzkrise im Mai 2009 rund 1,4 Millionen Kurzarbeitende gab, waren es im April 2020 fast sechs Millionen. Und das Ausmaß der Arbeitszeitreduzierung fiel ebenfalls deutlich höher aus. Aus beiden Größen lässt sich für den wirtschaftlichen Höhepunkt der Pandemie ein Volumen von etwa 2,2 Millionen über Kurzarbeit gesicherte Stellen gegenüber 330.000 elf Jahre zuvor errechnen.
Dagegen spielten Arbeitszeitverkürzungen durch das "Leerräumen“ von Arbeitszeitkonten diesmal eine weitaus geringere Rolle. Das könnte nach Analyse der Forscher unter anderem daran gelegen haben, dass solche Konten in kleineren Dienstleistungsbetrieben, die von der aktuellen Krise besonders stark betroffen sind, seltener existieren.
Und in der Industrie, wo es sie häufig gibt, dürften die Zeitspeicher weniger stark gefüllt gewesen sein als 2009. Denn in wichtigen Teilen des Verarbeitenden Gewerbes hatte schon vor dem akuten Einbruch durch Corona eine wirtschaftliche Flaute geherrscht.
Wichtige Verbesserungen bei der Ausgestaltung können Härten nur teilweise mildern
Die Bundesregierung habe aus der erfolgreichen Beschäftigungssicherung in der Finanz- und Wirtschaftskrise viele richtige Schlüsse gezogen, attestieren die Wissenschaftler. Deutlich rascher als 2009 wurden die Zugangsvoraussetzungen zu Kurzarbeit gesenkt, der Bezugszeitraum für Kurzarbeitergeld verlängert und die so genannten Remanenzkosten für Unternehmen durch Übernahme der vollen Sozialversicherungsbeiträge für Kurzarbeitende reduziert. Mit der Erhöhung des Kurzarbeitsgeldes nach längerem Bezug auf bis zu 80 Prozent vom ausgefallenen Nettoentgelt sei „zum ersten Mal ein stärkerer Fokus darauf gelegt worden, auf einer breiteren Basis Haushaltseinkommen zu sichern“.
Doch diese Verbesserungen können nur zum Teil ausgleichen, dass sich typische Kurzarbeitende während der Corona-Krise in einer schlechteren finanziellen Situation als 2009 befinden, zeigen Modellrechnungen der Wissenschaftler. Das liegt zum einen an der im Vergleich deutlich stärker reduzierten Arbeitszeit, zum anderen am geringeren Ausgangsgehalt, weil diesmal oft relativ niedrig bezahlte Beschäftigte in Dienstleistungsberufen betroffen sind, während 2009 vor allem Industriearbeitnehmer mit vergleichsweise höheren Einkommen in Kurzarbeit waren.
Bezogen auf einen Single in Steuerklasse eins lag das durchschnittliche Arbeitseinkommen vor Kurzarbeit 2009 bei 2125 Euro netto im Monat, während es 2020 lediglich 1677 Euro waren.
Im Zuge der Kurzarbeit sanken die Einkünfte im Beobachtungsmonat Mai 2009 um durchschnittlich 183 Euro, im April 2020 aber um 308 Euro, so dass 1942 bzw. 1369 Euro übrigblieben.
Der relative Einkommensverlust war damit auf dem wirtschaftlichen Höhepunkt der Corona-Krise mit 18,4 gut doppelt so hoch wie 2009 mit 8,6 Prozent (Tabelle 2 in der Studie).
Kurzarbeit bringt Geringverdiener trotz Arbeitsplatzssicherung in prekäre finanzielle Lage
Zwar ist dabei zu beachten, dass sich die höheren Kurzarbeitsgeldsätze bei längerem Bezug im April 2020 noch nicht ausgewirkt hatten. Die Einbußen bei manchen Kurzarbeitenden dürften also über die Monate etwas kleiner werden. Gleichwohl unterstreichen die exemplarischen Zahlen nach Analyse des IMK, dass Kurzarbeit nach den aktuellen gesetzlichen Regeln zwar erfolgreich Arbeitsplätze sichert, aber gerade Beschäftigte mit geringeren Löhnen in eine prekäre wirtschaftliche Lage bringen kann.
Da Niedriglohn-Beschäftigte häufiger in Unternehmen ohne Tarifvertrag arbeiten, können sie oft auch nicht auf eine Aufstockung des Kurzarbeitsgeldes durch den Arbeitgeber hoffen, die Gewerkschaften in etlichen Krisen-Tarifverträgen ausgehandelt haben. Das ist ein Grund dafür, dass Erwerbstätige mit zuvor schon geringerem Einkommen auch anteilsmäßig höhere Einbußen erleiden, wie beispielsweise die aktuelle Erwerbspersonenbefragung der Hans-Böckler-Stiftung gezeigt hat.
Noch größer ist die Schutzlücke bei Erwerbstätigen, die nicht unter die Sozialversicherungspflicht fallen. Minijobberinnen und Minijobber, die nicht in die Arbeitslosenversicherung einzahlen, konnten nicht in Kurzarbeit gehen und verloren auch deshalb besonders häufig ihre Stellen. Soloselbständige erhalten zwar in der Corona-Krise neu geschaffene staatliche Leistungen, doch anscheinend funktioniert diese Unterstützung oft längst nicht so reibungslos wie das Kurzarbeitsgeld.
Forscher empfehlen erhöhtes Kurzarbeitsgeld für Niedrigverdiener
Die Forscher konstatieren deshalb im Fazit ihrer Studie weiteren Verbesserungsbedarf: Sie schreiben:
„Die zu beobachtende Polarisierung auf dem Arbeitsmarkt während der Corona-Krise ist eine wichtige Lehre für den künftigen Zuschnitt des Systems von Kurzarbeit."
Ein wichtiger Ansatz könnten erhöhte Sätze beim Kurzarbeitsgeld für Niedrigverdiener sein. Zudem sollte darüber nachgedacht werden, geringfügig Beschäftigte und Selbständige in die gesetzliche Arbeitslosenversicherung einzubeziehen.
Themen:
LESEN SIE AUCH
Wichtiges für die Steuererklärung in Coronazeiten
Inflationssorgen auf neuem Rekordhoch
Sparwille sinkt im Jahresverlauf 2021 signifikant
Finanzielle Lage verschärft sich bei jungen Geringverdienern
Unsere Themen im Überblick
Themenwelt
Wirtschaft
Management
Recht
Finanzen
Assekuranz
Globale Asset Owner im Umbruch: Norwegens Staatsfonds überholt Japans
Anleihen kontra Aktien? Warum die Risikoprämie kippt
„Wir sind weit entfernt von einer KI-Blase“
Finanzielle Freiheit: Generation Z zwischen Ideal und Realität
Die neue Ausgabe kostenlos im Kiosk
Werfen Sie einen Blick in die aktuelle Ausgabe und überzeugen Sie sich selbst vom ExpertenReport. Spannende Titelstories, fundierte Analysen und hochwertige Gestaltung – unser Magazin gibt es auch digital im Kiosk.