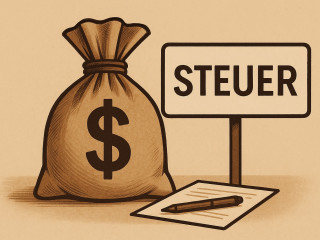Bislang hat sich die deutsche Stahl- und Metallbranche in der Wirtschaftskrise gut geschlagen: Trotz der enorm gestiegenen Energiekosten haben die Produzenten hohe Gewinne eingefahren. Doch das Blatt scheint sich jetzt zu wenden. Die Nachfrage bricht spürbar ein und erste Anzeichen für künftige Liquiditätsprobleme werden sichtbar
„Das Jahr 2021 war ein Boom-Jahr für die Branche“, sagt Frank Liebold, Country Director Germany bei Atradius. „Nachdem die Nachfrage nach Stahl und Metall im ersten Corona-Jahr merklich zurückgegangen war, kam der anschließende Aufschwung viel schneller als erwartet. Die Firmen kamen mit der Produktion kaum hinterher und die Verkaufspreise stiegen.“
Bis in die ersten Monate des Jahres 2022 hinein profitierten die Stahlproduzenten von dem Aufschwung – dann kam der Krieg in der Ukraine und damit steigende Preise und Rohstoffknappheit. „Seit dem 3. Quartal 2022 haben sich die Prognosen der Firmen im Stahlsektor merklich verschlechtert“, so Liebold. „Die Geschäftszahlen für das erste Quartal 2023 zeigen eine deutliche Marktabschwächung hinsichtlich Nachfrage und Preisen. Ich gehe davon aus, dass 2023 ein schwieriges Jahr werden wird“, so der Deutschland-Chef von Atradius. Bei den Schadenmeldungen ist im ersten Halbjahr sowohl bei der Fallzahl wie auch bei der Schadenssumme bereits ein deutlicher Anstieg zu erkennen.
Nach dem Aufschwung kommt die Krise
Darauf weisen auch erste Veränderungen im Zahlungsverhalten der Firmen hin. „Unsere Underwriter beobachten aktuell, dass die Unternehmen ihre Zahlungsziele im Einkauf immer häufiger verlängern. Die Firmen sorgen sich also offenbar um ihre Liquidität und versuchen so, mehr Spielraum zu bekommen“, sagt Liebold.
Das gelte besonders für Unternehmen mit Abnehmern im Automotive-Zuliefererbereich – neben den Branchen Bau und Maschinenbau einer der drei wichtigsten Abnehmersegmente der Stahlproduzenten: „Die Automobilbranche profitierte bisher noch von Nachholeffekten aus der Corona-Zeit und rechnete mit einer weiteren positiven Entwicklung. Allerdings sehen wir, dass gerade kleinere Zulieferer durch die Transformation des Automotive-Sektors hin zur Elektromobilität Probleme bekommen, ihre Produkte im gewohnten Umfang loszuwerden. Gleichzeitig fehlen ihnen die Ressourcen, um flexibel auf die veränderte Nachfrage zu reagieren. Hinzu kommt, dass auch die Aufträge für E-Autos zurückgehen. Die Branche sieht sich einem schwierigen zweiten Halbjahr gegenüber.“
Doch auch die Nachfrage aus dem Bau- und dem Maschinenbausektor geht merklich zurück: „In der Baubranche sind die Aufträge im ersten Quartal dieses Jahres um 20 Prozent eingebrochen“, sagt Liebold. „Und auch der Maschinenbau verzeichnet teilweise Auftragsrückgänge im zweistelligen Bereich. Besonders kleineren und mittleren Unternehmen im Stahl- und Metallsektor beschert die gesunkene Nachfrage Probleme, weil sie oft kleinere Kundenkreise einzelner Sparten bedienen. Kriselt es in einer solchen Sparte, können sie nicht auf andere Abnehmer ausweichen.“
Langfristig drohen der gesamten Branche große Herausforderungen
Die Branche muss sich angesichts der europäischen Maßnahmen gegen den Klimawandel auf grundlegende Umwälzungen und im Zuge dessen auf einen herausfordernden internationalen Wettbewerb einstellen: „Das Thema grüner Stahl beschäftigt den Sektor schon eine ganze Weile“, sagt Liebold. „Aber die Umstellung auf die wasserstoffbasierte Produktionsweise des Stahls erfordert Milliardeninvestitionen, die den Stahl teurer und damit international weniger wettbewerbsfähig machen“, so Liebold.
„Die höheren Produktionskosten müssen die Produzenten an die Abnehmer weitergeben. Die kritische Frage lautete allerdings: Bis zu welchem Grad sind letztere bereit, den Aufpreis zu bezahlen und wann beginnen sie auf Lieferanten im Ausland auszuweichen? Auch die Hersteller könnten schließlich ihre Produktion in Länder verlagern, in denen geringere Auflagen gelten.“
Dagegen plant die EU eine sogenannte „Grenzausgleichabgabe“, auch „Klimazoll“ genannt. Wer energieintensive Güter wie Stahl oder Zement in die EU einführt, soll ab Oktober einen CO2-Preis zahlen, so dass dadurch Wettbewerbsnachteile heimischer Unternehmen, die vergleichbare Waren herstellen, ausgeglichen werden. Ob dies abwanderungswillige Unternehmen, die Produktionskosten einsparen wollen und müssen, umstimmt, bleibt abzuwarten.
Kostenlose CO2-Zertifikate für energieintensive Produzenten in der EU hingegen sollen in den nächsten Jahren wegfallen. „Der Klimazoll stärkt europäische Produkte zwar innerhalb Europas gegenüber der ausländischen Konkurrenz, auf dem internationalen Markt sind europäische Firmen aber gegenüber Unternehmen aus Ländern mit geringeren CO2-Auflagen im Nachteil“, kritisiert Liebold und warnt: „Wenn hierauf nicht rechtzeitig reagiert wird, droht die Deindustrialisierung der deutschen Wirtschaft.“
Themen:
LESEN SIE AUCH
Schwaches Wachstum, steigende Insolvenzen – deutsche Wirtschaft unter Druck
Steigende Insolvenzen, neue US-Zölle, hohe Standortkosten: Atradius analysiert die größten Risiken für die deutsche Wirtschaft – und zeigt, wo Chancen liegen.
Wohin steuert Deutschlands Wirtschaft? Ein Wirtschaftsmodell unter Druck
Die deutsche Wirtschaft steht vor einem Wendepunkt. Das traditionelle Modell wird zunehmend durch globale Veränderungen erschüttert. Ein aktueller Artikel des Wall Street Journal beleuchtet die Schwächen dieses Ansatzes.
Atradius: Trübe Aussichten für 2024
Die jüngste Prognose von Atradius geht von einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 0,5 Prozent im Jahr 2023 aus, das sind 0,1 Prozentpunkte weniger als vor sechs Monaten. Die Wachstumsprognose für den Euroraum für 2024 wurde ebenfalls nach unten korrigiert.
Firmeninsolvenzen und Geschäftsaufgaben nehmen in Deutschland zu
Im ersten Halbjahr 2023 meldeten 8.570 Unternehmen Insolvenzen an – ein Anstieg von 20,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Trotz des Anstiegs ist nicht von einer "Insolvenzwelle" auszugehen, sondern vielmehr von einer Normalisierung im Insolvenzgeschehen.
Unsere Themen im Überblick
Themenwelt
Wirtschaft
Management
Recht
Finanzen
Assekuranz
Fiskalische Zeitenwende oder riskante Halse? Deutschlands Investitions- und Verteidigungskurs im Stresstest
Deutschland steht vor einem wirtschafts- und sicherheitspolitischen Kraftakt historischen Ausmaßes. Mit einem 500-Milliarden-Euro-Investitionspaket und dem Ziel, die Verteidigungsausgaben auf 3,5 % des BIP zu steigern, wagt die Bundesregierung eine fiskalische Zeitenwende. Doch der Spagat zwischen Wachstumsimpulsen, geopolitischer Abschreckung und haushaltspolitischer Stabilität ist riskant – ökonomisch wie gesellschaftlich.
Stromsteuer-Senkung bleibt aus: Verbraucher außen vor
Die Bundesregierung verabschiedet sich von ihrem Versprechen, die Stromsteuer für alle Verbraucher auf das EU-Mindestmaß zu senken. Nur Industrie und Landwirtschaft sollen entlastet werden. Während Ministerin Reiche von „finanzieller Wirklichkeit“ spricht, wirft der Steuerzahlerbund der Regierung einen Wortbruch vor. Die Entscheidung trifft besonders Mittelstand und Haushalte – und beschädigt die politische Glaubwürdigkeit der Ampel.
Ertragsteuern im Rückwärtsgang – aber Lohn- und Umsatzsteuer stabilisieren die Einnahmelage
Wie das Bundesfinanzministerium im Monatsbericht Juni 2025 mitteilt, hat sich das Steueraufkommen im Mai weiter positiv entwickelt – mit einer wichtigen Ausnahme: Die Ertragsteuern geraten spürbar unter Druck. Während Lohn- und Umsatzsteuer verlässlich tragen, wirft der Rückgang bei den ertragsbezogenen Einnahmen Fragen nach der konjunkturellen Substanz auf.
Krisenzeiten hinterlassen Spuren: Finanzielle Engpässe vor allem bei älteren Verbrauchergruppen
Trotz wirtschaftlicher Erholung nach der Corona-Pandemie und dem Beginn des Ukraine-Kriegs bleibt die finanzielle Lage vieler Haushalte angespannt. Welche Verbraucher-Gruppen besonders betroffen sind.
Die neue Ausgabe kostenlos im Kiosk
Werfen Sie einen Blick in die aktuelle Ausgabe und überzeugen Sie sich selbst vom ExpertenReport. Spannende Titelstories, fundierte Analysen und hochwertige Gestaltung – unser Magazin gibt es auch digital im Kiosk.