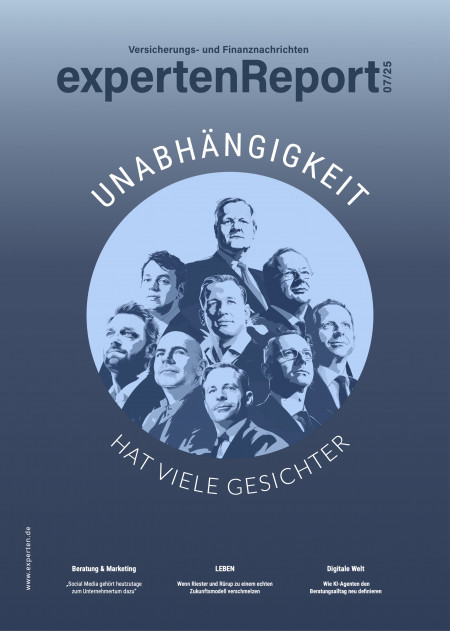Stürme, die das Dach abdecken oder Bäume auf Häuser krachen lassen, Hochwasser, das den Keller überflutet oder beschädigte Häuser durch Erdbeben – Hauptsache, gut versichert – sonst kann es ganz schnell sehr, sehr teuer werden. Gerade vor dem Hintergrund des Klimawandels gerät das Thema verstärkt in den Fokus. Antworten auf die wichtigsten Fragen gibt es hier.
Ein Großteil der Häuser in Deutschland ist nicht ausreichend gegen die finanziellen Folgen durch Schäden geschützt, die durch Naturgefahren entstanden sind.
Die Folgen der globalen Erwärmung sind jedoch schon jetzt deutlich zu spüren. Viele Verbraucher gehen davon aus, dass die Wohngebäude- und Hausratsversicherung für Schäden aufkommt.
Das ist jedoch nicht unbedingt der Fall, denn die Standardversicherungen regeln nur in einigen Fällen den finanziellen Ausgleich, der durch Naturgewalt bedingt ist. Die Hausratsversicherung zahlt dann, wenn Schäden an versicherten Gefahren am Hausrat entstanden sind.
Das kann durch einen Brand geschehen sein, durch ein Leitungswasserschaden oder auch durch einen Blitzschlag und Sturm. In diesem Fall wird beschädigter Hausrat von den Versicherungen meist bis zum Neuwert ersetzt. Bei Gebäudeschäden hingegen greift die Wohngebäudeversicherung, sie übernimmt zum Beispiel die Kosten für die Reparatur eines Dachs oder zerstörter Fenster.
Vereinfacht gesagt, kommt die Hausratsversicherung für die Begleichung von Schäden am beweglichen Hausrat auf, die Wohngebäudeversicherung hingegen zahlt bei Schäden, die das Gebäude und festverbaute Gebäudebestandteile betrifft.
Durch die Wohngebäudeversicherung und die Hausratsversicherung sind zum Beispiel Sturm- und Hagelschäden abgedeckt, Blitzschäden werden von der Feuerversicherung übernommen. Die Hausratsversicherung zahlt bei Blitzeinschlag häufig jedoch nicht bei Überspannungsschäden.
Elementarversicherung zahlt bei Schäden durch Naturgewalten
Das bedeutet jedoch nicht, dass durch die beiden Versicherungen alle Schäden abgedeckt sind, die durch Naturgewalten entstehen. Gegen die finanziellen Folgen von Zerstörungen etwa durch Lawinen und Erdbeben, aber auch durch Überschwemmungen und Erdrutsche, sollten sich Hausbesitzer mit einer Elementarversicherung absichern, die im Grunde als Erweiterung zur Wohngebäude- und Hausratsversicherung zu verstehen ist und auch nur in Kombination mit einer dieser beiden Versicherungen abgeschlossen werden kann. Seitens der Politik wird derzeit sogar über eine Pflichtversicherung diskutiert.
In der Regel gilt eine Elementarversicherung jedoch nur bei Immobilien, die ständig bewohnt sind. Ferien-, Wochenend- oder Gartenhäuser können nicht versichert werden, genauso wenig wie freistehende Garagen. Üblich ist außerdem ein Selbstbehalt.
In den meisten Fällen deckt die Elementarversicherung folgende Schadensursachen ab:
- Erdsenkungen, Erdrutsch, Erdfall
- Schneedruck
- Überschwemmungen
- Wasser-Rückstau durch Starkregen
- Erdbeben
- Vulkanausbrüche
In Deutschland ist es unter den Naturgefahren überwiegend Starkregen, der zu Versicherungsschäden führt. Wasser, das von der Straße in Gebäude eindringt und Überflutungen beispielsweise nicht von Standardversicherungen abgedeckt.
Für Immobilienbesitzer oft eine Katastrophe, wie die Jahrhundertflut in Nordrhein-Westfalen im Juli 2021 zeigte. Hier gab es nicht nur mehrere Tote, sondern es entstanden Sachschäden in Milliardenhöhe, und bei vielen Einwohnern reichte der Versicherungsschutz nicht aus.
Auch Elementarversicherung zahlt nicht immer
Allerdings gilt eine Elementarschadenversicherung in solchen Fällen, wenn Wasser an die Oberfläche gelangt ist und nicht bei Schäden, die zum Beispiel durch Grundwasser entstehen. Wenn ein Keller dadurch geflutet und beschädigt wird, gibt es nur wenig Versicherer, die die Kosten übernehmen.
Auch die Kostenübernahme bei Schäden, die durch Sturmfluten entstanden sind, gehört nicht ins Portfolio von Versicherern. Auch wichtig zu wissen: Die Versicherer kommen zwar für die finanziellen Kosten auf, die durch Erdbeben, Erdrutsch oder Erdsenkung entstanden sind, jedoch muss in diesem Fall die Natur Verursacher des Schadens sein.
Sind die Schäden Menschen gemacht, zum Beispiel durch Baustellenarbeiten oder sogar Fracking, werden die finanziellen Folgen nicht übernommen. Gleiches gilt für Schneeschäden – die nicht übernommen werden, wenn sie durch geschmolzenen Schnee entstanden sind.
Bei Abschluss einer Elementarversicherung werden folgende Leistungen übernommen:
Wohngebäudeversicherung mit Elementarversicherung: Reparatur am und im Haus und an den Nebengebäuden, Abriss von Gebäuden, Trockenlegung und Sanierung von Immobilien, Kosten für alternative Unterkünfte, wenn eine Immobilie vorübergehend nicht bewohnt werden kann, Kostenübernahme bei Mietausfällen, Bau eines gleichwertigen Gebäudes.
Hausratsversicherung mit Elementarversicherung: Erstattung des Wiederbeschaffungspreises des beschädigten Inventars sowie Reparaturkosten
Wie teuer ist eine Elementarversicherung?
Wer eine Elementarversicherung abschließt, muss mit durchschnittlich etwa 50 Prozent Aufschlag auf die Gebäudeversicherungsprämie rechnen.
Die Tarife für eine Elementarversicherung richten sich unter anderem nach den jeweiligen Risiken in verschiedenen Gebieten in Bezug auf Überschwemmungs-, Lawinen- oder Erdrutschgefahren: Wer in einer gefährdeten Region lebt, in dem es häufig zu Naturereignissen kommt, sollte den Abschluss einer Elementarversicherung ins Auge fassen.
Hinweise über Risikogebiete gibt zum Beispiel der Versicherungsverband GDV mit dem Kompass Naturgefahren. Hier können Verbraucher ihr persönliches Risiko abschätzen. Je größer das Risiko von Schäden durch Naturgewalten in dem jeweiligen Gebiet ist, desto höher fallen die Tarife, die sich im Übrigen nach Straße und Hausnummer richten (und nicht nach der Postleitzahl) aus.
Die Ermittlung der Risikogebiete durch die Versicherungswirtschaft basiert auf dem sogenannten ZÜRS (Zonierungssystem für Überschwemmung, Rückstau und Starkregen). Insgesamt gibt es vier Tarifzonen, von denen Zone 4 die risikoreichste darstellt.
- Zone 1: Hier kommt es seltener als alle 200 Jahre zu Hochwasser
- Zone 2: Hochwasser kommt hier alle 50 bis 100 Jahre vor
- Zone 3: Hochwasser tritt alle 10 bis 50 Jahre auf
- Zone 4: Hier kommt es mindestens alle zehn Jahre zu Hochwasser
Diese Risikobemessung fußt unter anderem aus vergangenen Schadensmeldungen. Aber: Es gibt sogar Regionen in Deutschland, in denen die Versicherungen keine Elementarversicherungen anbieten.
Themen:
LESEN SIE AUCH
Naturgefahrenbilanz: 2022 war ein durchschnittliches Schadenjahr
VKB: Schadenaufwand zwischen 150 und 225 Mio. Euro
25 Mio. Schäden durch Kolle
Elementarschutz auf dem Verhandlungstisch: Politik und Verbände drängen auf Pflichtversicherung
Unsere Themen im Überblick
Themenwelt
Wirtschaft
Management
Recht
Finanzen
Assekuranz
Elementar Re: Versicherer legen Modell für neues Sicherungssystem vor
Einbruchschutz: Umfrage zeigt große Sorgen
R+V warnt vor Frostschäden
Wohngebäudeversicherung: Leitungswasserschäden steigen drastisch
Die neue Ausgabe kostenlos im Kiosk
Werfen Sie einen Blick in die aktuelle Ausgabe und überzeugen Sie sich selbst vom ExpertenReport. Spannende Titelstories, fundierte Analysen und hochwertige Gestaltung – unser Magazin gibt es auch digital im Kiosk.