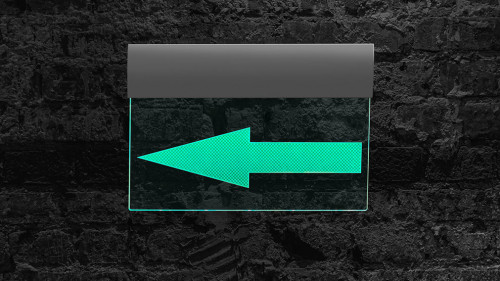Bei Stromausfall fällt vielen Menschen die Orientierung in großen Gebäuden schwer. In Deutschland ist deshalb eine Sicherheitsbeleuchtung vorgeschrieben, die hohe Anforderungen erfüllen muss.
Ortsfremde Personen können sich bei Dunkelheit, etwa bei einem Stromausfall, nur schwer in Gebäuden orientiert. Laut DIN EN 1838 müssen jedoch zumindest Flucht- und Rettungswege immer gut ausgeleuchtet sein. Die Norm schreibt zudem eine Beleuchtung potenzieller Gefahrenstellen und weiterer sicherheitsrelevanter Bereiche vor. Öffentliche Gebäude und Unternehmen realisieren dies über ein zweites unabhängiges Beleuchtungssystem, das auch bei einer Störung der allgemeinen elektrischen Beleuchtung aktiv bleibt.
Aufgaben der Sicherheitsbeleuchtung
Die Sicherheitsbeleuchtung soll bei einem Ausfall der allgemeinen Beleuchtung für ein Mindestmaß an Helligkeit sorgen. Dies soll ortsfremden, aber auch ortskundigen Personen mit in Notsituationen bei der Orientierung helfen und ein sicheres Erreichen der Flucht- und Rettungswege ermöglichen. Die Aufgaben der Sicherheitsbeleuchtung sind also vor allem:
- Menschen das sichere Verlassen des Gebäudes ermöglichen
- In einer Notsituation (zum Beispiel Gebäudeevakuierung) Panik zu verhindern
- Bei der Beurteilung von Unfällen und Gefahren helfen
- Die Flucht- und Rettungswege gut erkennbar zu machen.
- Die Sicherheitsbeleuchtung muss gleichmäßig hell sein. Das Verhältnis von der kleinsten zur größten Beleuchtungsstärke darf maximal bei 1:40 liegen.
- Die Sicherheitsbeleuchtung muss ihre volle Lichtleistung höchstens 15 Sekunden nach dem Ausfall der Allgemeinbeleuchtung erreichen.
- Der Farbwiedergabeindex der Lichtquellen muss mindestens Ra40 haben.
- Die Mittelachse der Flucht- und Rettungswege muss mindestens eine horizontale Beleuchtungsstärke von 1 Lux haben.
- Die Sicherheitsbeleuchtung auf Flucht- und Rettungswegen beleuchtet den Flucht- und Rettungsweg und hilft Personen somit bei der Erkennung von Niveauunterschieden (zum Beispiel Treppen) und Niveauunterschieden. Zudem kennzeichnet sie Erste-Hilfe-Stellen, Brandbekämpfungseinrichtungen (zum Beispiel Feuerlöscher) und Meldeeinrichtungen. Ihr Ziel ist es, allen Menschen einen sicheren Weg zum Ausgang zu zeigen.
- Die Antipanikbeleuchtung soll verhindern, dass es in Versammlungsstätten bei einem Ausfall der allgemeinen Beleuchtung zu Panik kommt. Sie stellt sicher, dass alle anwesenden Personen die Flucht- und Rettungswege sicher erreichen können.
Vorgeschrieben ist eine Antipanikbeleuchtung, wenn ohne diese die Fluchtwege nicht eindeutig erkannt werden können oder wenn die gesamte Fläche als Rettungsweg dienen kann. Auch Aufzüge sowie Konferenzräumen über 60 Quadratmeter Größe und einen markierten Fluchtweg müssen über eine Antipanikbeleuchtung verfügen. - Arbeitsstätte und Arbeitsplätze mit besonderer Gefährdung müssen über eine Sicherheitsbeleuchtung verfügen. Unternehmen sind daher verpflichtet, zum Schutz ihrer Angestellten eine Gefährdungsbeurteilung zu erstellen, die ermittelt, ob bei einem Ausfall der allgemeinen Beleuchtung alle Mitarbeiter gefahrenlos ihren Arbeitsplatz verlassen können.
Bei Arbeitsplätzen mit besonderer Gefährdung (zum Beispiel Baustellen) muss eine Sicherheitsbeleuchtung von mindestens 15 Lux spätestens 0,5 Sekunden nachdem Ausfall der Hauptbeleuchtung aktiv sein. - Die Erstprüfung nach DIN 5035-6 erfolgt vor der generellen Inbetriebnahme. Es wird dabei kontrolliert, ob die Lichttechnik ihre Funktion erfüllt und ob der Batterieraum den Anforderungen entspricht.
- Bei der täglichen Prüfung wird per Sichtprüfung kontrolliert, ob die Sicherheitsbeleuchtung betriebsbereit ist. Ein Funktionstest wird nicht durchgeführt.
- Bei der wöchentlichen Prüfung wird die Stromquelle für Sicherheitszwecke aktiviert und es wird jede einzelne Leuchte getestet. Diese Prüfung soll einen Netzausfall simulieren. Auch die Stromerzeugungsaggregate werden nach DIN 6280-13 geprüft
- Die Jährliche Prüfung ist besonders umfangreich. Hierbei wird die Stromquelle für Sicherheitszwecke über die erforderliche Bemessungsbetriebsdauer über die Zuschaltung aller angeschlossenen Verbraucher belastet. Zudem erfolgt eine Prüfung der Stromerzeugungsaggregate nach DIN 6280-13 und eine Prüfung der Batterien nach DIN EN 50272-2.
Anforderungen der Sicherheitsbeleuchtung
Die wichtigsten Anforderungen an die Sicherheitsbeleuchtung sind laut den Technischen Regeln für Arbeitsstätten ASR A3.4/3 und DIN EN 1838:
Zudem sind nach EN ISO 7010 auch die Rettungszeichenleuchten mit grün-weißen Piktogrammen (stilisierte Personen mit Pfeil in Fluchtrichtung) ein Bestandteil der nötigen Sicherheitsbeleuchtung.
Arten der Sicherheitsbeleuchtung
Die Sicherheitsbeleuchtung wird unterteilt in Sicherheitsbeleuchtung für Rettungswege, Antipanikbeleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung für Arbeitsplätze mit besonderer Gefährdung.
Überprüfungen, Wartungen und Instandsetzungen der Sicherheitsbeleuchtung
Der Ausfall einer Sicherheitsbeleuchtung kann erste Folgen haben. Die Überprüfungen, Wartungen und Instandsetzungen darf deshalb nur nach den technischen Regeln für Betriebssicherheit (TRBS) und von Fachpersonal nach DIN VDE 0105-100, DIN VDE 1000-10 erfolgen. Meist handelt es sich dabei um Mitarbeiter des Herstellers des Beleuchtungssystems.
Themen:
LESEN SIE AUCH
Sicherheit geht vor: praktische Maßnahmen für Arbeitssicherheit in der Werkstatt
Arbeitsunfälle können nicht nur menschliches Leid verursachen, sondern auch zu Produktionsausfällen und finanziellen Verlusten führen. Deshalb ist es wichtig, dass die Arbeitssicherheit in der Werkstatt oberste Priorität hat.
Corona beschert komplizierte Weihnachtsfeiern
Bei der Planung der diesjährigen Weihnachtsfeier stehen viele vor der kniffeligen Frage: kann man angesichts des Corona-Ansteckungsrisikos dennoch dieses Jahr in Persona feiern oder ist wieder ein „digitales Firmenfest“ angeraten? Was es beim Feiern zu beachten gilt.
Hygienekonzept für den Betrieb - was heißt das?
Unsere Themen im Überblick
Themenwelt
Wirtschaft
Management
Recht
Finanzen
Assekuranz
Wie Unternehmer Steuern im Voraus sparen können
Wie heißt es zum Jahreswechsel immer so schön? Neues Jahr, neues Glück. Um diesem geflügelten Wort auch Taten folgen zu lassen, gibt die Gesetzgebung Unternehmern einige praktische Hilfsmittel an die Hand, damit sich der geschäftliche Erfolg einstellt. Eines davon ist der Investitionsabzugsbetrag, kurz IAB. Wie der richtig genutzt wird, erklärt Prof. Dr. Christoph Juhn, Professor für Steuerrecht an der FOM Hochschule und geschäftsführender Partner der Kanzlei JUHN Partner im Gastbeitrag.
Die Team- und Zusammenarbeit neu justieren
Viele Teams in den Unternehmen stehen aktuell vor der Herausforderung, sich selbst und ihre Zusammenarbeit neu zu definieren, um ihre Leistungsfähigkeit zu bewahren. Das zeigt eine Befragung von Personalverantwortlichen durch die Unternehmensberatung Kraus & Partner.
Mit Mitarbeiter-Benefits die Attraktivität als Arbeitgeber erhöhen
Deutschlands Mittelstand steht aktuell vor einem Dilemma. Die Auftragsbücher zahlreicher Firmen sind gut gefüllt. Doch leider fehlen Fachkräfte, um die nötigen Aufgaben zu übernehmen. Mitarbeiter-Benefits können helfen, sich als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren. Werden sie richtig aufgebaut, können sie im Wettkampf um die besten Leute ausschlaggebend sein.
Voll versteuert!? Drei Stolperfallen, die Unternehmen mühelos vermeiden können
Teure Materialien sowie steigende Energie- und Transportpreise führen in zahlreichen Unternehmen zu Sparmaßnahmen. Unvorhergesehene und potenziell kostspielige Steuernachzahlungen können in einer angespannten Situation den Druck auf die finanziellen Ressourcen empfindlich erhöhen. . Dabei lassen sich einige steuerliche Stolperfallen umgehen.
Die neue Ausgabe kostenlos im Kiosk
Werfen Sie einen Blick in die aktuelle Ausgabe und überzeugen Sie sich selbst vom ExpertenReport. Spannende Titelstories, fundierte Analysen und hochwertige Gestaltung – unser Magazin gibt es auch digital im Kiosk.